Was die Schweizer sehen und hören
Die Berner Kommunikationswissenschaftler hatten vergangene Woche zur Tagung «Schneller, kürzer, seichter – gefährdeter Tiefgang in den Medien?» eingeladen. Auf dem Programm stand auch die Publikumsforschung. Ein Bericht über die Radio- und TV-Nutzung der Schweizer.
Der Anlass für die Tagung zum Thema «Tiefgang in den Medien» war das 60-jährige Jubiläum der Sendung «Echo der Zeit». Eingeladen hatte das Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Uni Bern gemeinsam mit Radio DRS. Zu Wort kamen Wissenschaftler und Praktiker, unter anderem ging es um die Publikumsforschung: Was wollen wir sehen und hören? Und was sehen und hören wir tatsächlich? Helmut Thoma, ehemaliger Chef von RTL, sagte einst: «Der Wurm muss dem Fisch schmecken – nicht dem Angler». Sprich: Das Programm muss den Zuschauern und Zuhörern gefallen, nicht seinen Machern. Was aber will das Publikum?
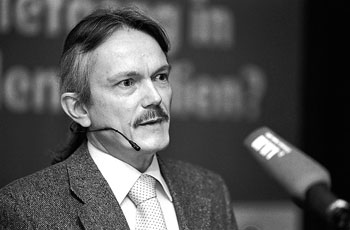
Hintergrundmusik
Zunächst ging es um das Medium Radio. Bislang galt das Radio lediglich als Tagesbegleiter. Der Sender läuft im Hintergrund, während sich der Hörer anderen Dingen widmet. Und am liebsten hört man im Radio Musik. Frühere Studien der Radiopublikumsforschung bestätigten dies. Die damals angewendete Interviewmethode erfasste jedoch das tatsächliche Hörverhalten nur ungenügend, wie Heinrich Anker, Medienreferent bei Schweizer Radio DRS, erläuterte. «Die Leute wurden gefragt, was sie am vorigen Tag gehört haben. Die Interviewten erzählten, was sie gehört zu haben glaubten.»
Eine neue Erfassungsmethode, die Radiocontroluhr, zeigte jedoch: was wir meinten gestern gehört zu haben, muss nicht das sein, was wir gestern gehört haben. So erreichen laut Radiocontrolforschung auch Wortsendungen, wie das «Echo der Zeit» und diverse Infomagazine, viele Hörer. Die Sendungen seien weniger ein Ausschalt- denn ein Einschaltgrund, so Anker. Eine 2004 durchgeführte Befragung der Hörer nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen an das Radio bestätigte, dass die Auffassung, Radio sei bloss ein Stimmungsmacher im Hintergrund, zu kurz greift: Neben Kurzweil und Abwechslung erwarten die Befragten vom Sender Qualität, Glaubwürdigkeit und einen regionalen Bezug. Von «kürzer, schneller, seichter» könne aus Sicht des Radiopublikums also keine Rede sein, sagte Anker.
Music Star oder Tagesschau?
Über die Publikumsforschung beim Fernsehen sprachen Manuel Dähler und Markus Jedele vom Forschungsdienst «srgssr idée suisse». Wie sie zeigten, ist der tägliche Fernsehkomsum in den letzten Jahren auch in der Schweiz kontinuierlich gestiegen. 1994 schaute man durchschnittlich 124 Minuten fern, zehn Jahre später ist es fast eine halbe Stunde mehr, wobei die über 65-jährigen mit 230 Minuten pro Tag am längsten vor der Glotze sitzen.
Ohne TV würde das Publikum vor allem Information und Entspannung vermissen, das zeigen Daten des Forschungsdienstes vom Schweizer Fernsehen. Das Hauptinteresse liegt laut Zuschauerangaben bei Nachrichten, Live-Reportagen und Dokumentationen über fremde Länder.

Traditionelle, Experimentalisten und bürgerliche Mitte
Aber was sehen die Schweizer tatsächlich? Beim Schweizer Fernsehen gehörten im laufenden Jahr die Tagesschau, Meteo, die WM-Qualifikationsspiele der Fussballnationalmannschaft sowie Benissimo und Music Star zu den Sendungen mit den höchsten Einschaltquoten. Dähler und Jedele zeigten auch, welche Sendungen von welchen Gruppen, im Fernseh-Forscher-Jargon Sinus-Milieus genannt, gesehen werden.
Sinus-Milieu fassen Menschen zusammen, die sich in ihren Lebenszielen, ihrer Lebensauffassung und ihrer sozialen Lage ähneln. So gibt es beispielsweise die genügsam Traditionellen, die Experimentalisten oder die bürgerliche Mitte. Die letztere und grösste Gruppe sieht mit Vorliebe die Tageschau und den Wetterbericht. Die Sendung «Traumjob» wurde vor Allem von Statusorientierten gesehen. Und «Black’n Blond» scheint bei konsumorientierten Arbeitern Anklang zu finden.
Falscher Wurm an der Angel
Das Schweizer Publikum erwartet demnach von Radio und Fernsehen sowohl Unterhaltung als auch Information. Die Programmmacher erfassen laufend, ob und wie sich das Publikumsinteresse ändert. Dennoch: «Die Publikumsforschung darf nicht zum Mass aller Dinge werden», betonte Anker. Sonst werde sie zum Korsett und ersticke kreative Anstösse. Und noch eine Erkenntnis liefert die Forschung: Das Publikum ist durchaus fähig, selber ein Urteil zu fällen. So sind die Einschaltquoten der stark kritisierten Show «Black’n Blond» in den zwei Monaten seit der ersten Ausstrahlung massiv gesunken. Offensichtlich haben die Angler einen wenig schmackhaften Wurm an die Angel gehängt.