Psychotherapie wirkt mitten im Gehirn
Das menschliche Gehirn ist flexibel. Es kann sogar seine Strukturen verändern – zu unseren Gunsten, wie der Berner Neurowissenschaftler Dominik Bach an der «Woche des Gehirns» erläutert: Dadurch können wir nämlich psychische Erkrankungen wie Phobien loswerden.
Die Boeing rollt auf die Startbahn. Und schon hebt der Sitznachbar fast von selbst ab: Seine Hände zittern und der Schweiss perlt übers Gesicht: Flugangst. Doch eine Phobie kann heutzutage meist geheilt werden: «Durch spezifische Psychotherapie verlieren die Betroffenen ihre irrationale Angst», sagt Dominik Bach von den Universitären Psychiatrischen Diensten der Uni Bern (UPD). Sie lernen in wiederholten Konfrontationen zum Beispiel mit der gefürchteten Hausspinne, dass das «Untier» höchstens einer Fliege etwas zuleide tut. Dieses Lernen kann die Neurowissenschaft jetzt im menschlichen Gehirn nachweisen – mittels bildgebenden Neuroimaging-Verfahren wie der Kernspinntomografie: Die Aktivität in den Emotions-Hirnzentren eines Phobikers ist beim Anblick einer Spinne vor seiner Therapie viel höher als nachher. Dominik Bach beschäftigt sich in seinen Untersuchungen damit, wie diese Veränderung zustande kommt; er will jetzt die Hirnaktivität während einer Therapiestunde messen.
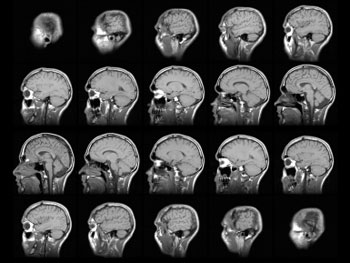
«Mit solchen Ergebnissen wird zwischen der Psychologie und der Neurowissenschaft ein Zusammenhang geschaffen, welcher früher geleugnet wurde», sagt der Neurowissenschaftler. An der «Woche des Gehirns» hält Dominik Bach einen Vortrag zum Thema «Psychotherapie und Neuroplastizität» (siehe Link).
Stets ins Bewegung
«Die Neuroplastizität ist die Fähigkeit unseres Gehirns, seine Strukturen immer wieder äusseren Umständen anzupassen», erklärt Bach. Fast scheint es, als sei das Organ eine Modelliermasse: Die Nervenzellen (Neuronen) sind fähig, sich plötzlich durch vermehrte Ausbildung von Synapsen – den Schnittstellen zu den anderen Neuronen – enger miteinander zu verbinden. Und die Rezeptoren der Botenstoffe, welche an den Nervenzellenden lokalisiert sind, können durchlässiger werden; somit werden Neurotransmitter, welche wesentlich zum psychischen Gleichgewicht des Menschen beitragen, leichter ausgeschüttet und auch effizienter aufgenommen. Sogar ganze Hirnareale können völlig andere Funktionen übernehmen. Dies veranschaulicht Dominik Bach wie folgt: Jeder Finger ist durch einen genau definierten Bereich im Gehirn gesteuert. Muss einem Patienten ein Finger amputiert werden, übernimmt der zugehörige Hirnteil zusätzliche Aufgaben für die übrigen Finger. «Man würde eigentlich erwarten, dass das betreffende Areal brach liegt», so Bach. «Doch das Gehirn will aktiv sein, ist plastisch und sucht sich neue Aufgaben.»
Neue Strassen im Gehirn
Auf der Grundlage der Neuroplastizität beruht schliesslich der Effekt einer Psychotherapie. «Sie wirkt auf die zelluläre Ebene im Gehirn und dadurch auf das Wohlbefinden eines Patienten», wie Bach sagt. «Durch das gezielte Herbeiführen von Lebenserfahrungen in einer Therapie kann ein Mensch von gewissen psychischen Problemen genesen.» Phobiker verlieren durch Gewöhnung ihre Panik, die Neuronen in den Emotionszentren scheinen nach einer Psychotherapie wieder in gesunder Art und Weise zu funktionieren. «Vergleichen kann man die neuronale Strukturveränderung mit einer Strasse, die neu gebaut wird», erklärt Dominik Bach, «der Verkehr läuft anschliessend reibungsloser.» Unklar bleibt bisher allerdings, ob die Angst effektiv verschwindet, oder ob das Gehirn die Schreckimpulse nur hemmt. «Das ist Gegenstand der aktuellen Forschung», so Bach.
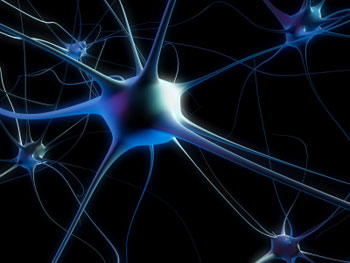
Auf der Suche nach Modellen
Angstleidende sprechen gut auf eine gezielte Psychotherapie an – funktioniert das Prinzip bei Depressionen ebenso? «Auch in diesem Fall hilft eine Psychotherapie», so Dominik Bach. Nur sei bei der Depression die Wirkung der Behandlung auf die neuronale Ebene kaum bekannt. «Die Neurowissenschaft forscht bevorzugt an Angststörungen, da bei diesen Erkrankungen die Therapie schnell Erfolge zeigt – und weil meist nur ein Lebensbereich betroffen ist.» Korrelationen zwischen Psychotherapie und Hirnaktivitäten liessen sich dadurch eindeutiger erkennen. Bach hofft, dass die Studien über Phobien und ähnliche psychische Leiden wie die Posttraumatische Belastungsstörung alsbald als Modelle für andere Gemütserkrankungen dienen könnten. «Aber die Neuroimaging-Forschung über den Effekt von Psychotherapien steckt erst in den Kinderschuhen», so der Berner Forscher.