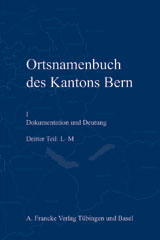«M» wie Marzili
Alle Namen von Orten, Städten, ebenso die von Bergen und Flüssen: Sprachwissenschaftler der Uni Bern tragen die Ortsbezeichnungen des deutschsprachigen Kanton Bern zusammen. Jetzt erscheint der dritte Teil dieses umfassenden Nachschlagewerks.
Ein Deutungsversuch geht auf eine angebliche, dem heiligen Marcellus geweihte Kapelle zurück. Von der fehlt jedoch bis heute jede Spur. Eine andere Theorie geht davon aus, dass das Wort an einen Deutschen anlehnt, der «Marsili» hiess. Was oder wer nun dem Berner Marzili wirklich den Namen gab, bleibt bisher ein Geheimnis. Klar ist nur, dass das an der Aare gelegene Quartier ab 1295 mit dieser Bezeichnung in den Schriften auftaucht. So dokumentiert es das Ortsnamenbuch des Kantons Bern – auf Seite 242 des dritten Teils des ersten Bandes. Dieser steht bald in den Regalen der Buchhandlungen. Am Freitag, 16. Mai, findet im Uni-Hauptgebäude die Vernissage des 360seitigen Nachschlagewerks statt.

Drei Viertel der Namen sind ausgestorben
Das Ortsnamenbuch bietet jedoch mehr als eine Einordnung der Namenherkunft. «Das Ziel ist, möglichst alle Mundartlautungen der bernischen Orts- und Flurnamen zu erfassen, also alle Toponyme» sagt der interne Projektleiter und Sprachwissenschaftler Thomas Franz Schneider: Dabei finden nicht nur Ortschaften und Städte Eingang in die Sammlung, sondern auch Siedlungs- und Flurnamen, ebenso wie die Bezeichnungen von Flüssen, Bergen und Wäldern. «Wir dokumentieren alle lebendigen Namen, aber auch solche die nicht mehr aktiv gebraucht werden und nur noch aus der Überlieferung bekannt sind», erklärt Schneider; drei Viertel der in historischen Dokumenten belegten Namen sind nämlich ausgestorben. Die Datenaufnahme im Gelände, «draussen bei den Alteingesessenen», hatte damals 1942 unter der Leitung des Dialektologen Paul Zinsli begonnen, der die Sammlung der Berner Ortsnamen gestartet hatte.
Namen mit «M» und «L»
Thomas Franz Schneider erklärt, dass dem Projekt ein Bundesratsentschluss von 1938 zugrunde liegt, der die Kantone verpflichtete, die Orthographie von Ortsnamen für die amtliche Vermessung festzulegen. Mit dem vorliegenden Buch wird Zinslis Werk weitergeführt: Dieser Teil widmet sich den Namen mit Anfangsbuchstaben L und M und basiert auf einer Sammlung von rund einer Million verzettelter Einträge. Die beiden ersten Teile nach alphabetischer Reihenfolge erschienen 1976 beziehungsweise 1987. Während der erste Band mit den voraussichtlich sieben Teilen die Toponyme sammelt, soll der spätere zweite Band schliesslich deren sprachwissenschaftliche, siedlungs- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge darstellen.
Nur mit Anleitung lesbar
Wirft man einen Blick in das Buch, springen unter den Namen wie Marzili, Längnou, Linde römische Zahlen, Abkürzungen, Begriffe in phonetischer Schrift entgegen: Die Darstellung der Namen ist kodiert und verdichtet, «sonst wäre das Buch viermal so dick», sagt Sprachwissenschaftler Schneider und beruhigt: «Damit die Einträge verständlich werden, liegt ein Schlüssel bei.» Mithilfe der Anleitung wird schnell ersichtlich, in welchen Teilen des Kantons die Namen in welchen Varianten vorkommen, und wie man sie ausspricht.
Die Forschungsstelle für Namenkunde, welche für das Ortsnamenbuch des Kantons Berns verantwortlich zeichnet, ist dem Institut für Germanistik angegliedert und steht unter der Leitung von Frau Prof. Elke Hentschel. Sieben Personen tragen sorgfältig Belege aus den Gemeinden des deutschsprachigen Teils des Kantons Bern (ohne Jura und Laufental) zusammen: Nicht nur für die Sprachwissenschaftler sondern auch für interessierte Privatpersonen, «etwa Heimatforscher im Bauerndorf», so Schneider. Oder Stadtbernerinnen, die wissen wollen, warum die Wiese, auf der sie sich sonnen, so heisst, wie sie heisst.
Weiterführender Link