Vereint und gespalten zugleich
Die direkte Demokratie bindet verschiedene Gruppen in die Politik ein und wirkt stabilisierend. Sie dient den Parteien aber auch zur Mobilisierung im Abstimmungskampf und verstärkt damit gesellschaftliche Spaltungen. In seinem neuen Buch wägt der Politikwissenschafter Wolf Linder beide Seiten der Medaille gegeneinander ab.
uniaktuell: Herr Linder, Ihr neues Buch trägt den Titel «Gespaltene Schweiz – Geeinte Schweiz». Worum geht es?
Wolf Linder: Es ist das Ergebnis eines Nationalfonds- Forschungsprojekts. In zwei Dissertationen sind dabei alle Volksabstimmungen seit 1874 – das sind mehr als 500 – unter der gleichen Fragestellung untersucht worden: Spalten sie die Stimmbürgerschaft wegen der grossen Konflikte, um die es geht, oder führen sie das Volk eher zusammen, weil der Selbstentscheid der Stimmbürger auch von der Minderheit akzeptiert wird?

Baustelle Bundeshaus: Die Regierungsparteien geben nur in einer von fünf Volksabstimmungen eine einheitliche Parole aus. (Bild: ma)
Wie kann man so etwas überhaupt untersuchen?
Die beiden Mitautoren Regula Zürcher und Christian Bolliger haben zu jedem Abstimmungskampf untersucht, welche dauerhaften Konflikte – etwa zwischen Kapital und Arbeit oder zwischen Stadt und Land – thematisiert und zur Mobilisierung verwendet wurden. Dann haben sie das Stimmverhalten analysiert: Stimmten zum Beispiel Arbeiterbezirke eher für die AHV als wohlhabende Wohnbezirke, die ländlich-bäuerlichen Bezirke stärker für die vielen Landwirtschaftsvorlagen als die Städte? So wurde der Grad der Polarisierung der Stimmbürgerschaft ermittelt. Unser Buch fasst die längerfristige Entwicklung solcher Spaltungen zusammen.
Was wiegt nun stärker in der direkten Demokratie: Ihre Integrationskraft oder die Tatsache, dass sie gesellschaftliche Spaltungen durch den permanenten Abstimmungskampf überhöht?
Integrativ war die direkte Demokratie insofern, als sie im 20. Jahrhundert die politische Zusammenarbeit der Parteien förderte. Aber: Einzelne Parteien nutzen die fallweise Opposition in Abstimmungskämpfen auch trotz ihrem Einsitz im Bundesrat. Darum werden die gesellschaftlichen Gegensätze nach wie vor stark betont, durch Mobilisierung neu belebt und manchmal auch überhöht, um eine Abstimmung zu gewinnen. Direkte Demokratie kann damit auch konfliktfördernd wirken und bleibt ein Gegenpol zur politischen Konkordanz. Sie ist ambivalent für den gesellschaftlichen Frieden.
In der Einleitung sprechen Sie davon, dass einige gesellschaftliche Spaltungen trotz der Regierungskonkordanz in den letzten Jahrzehnten an Intensität zunehmen. Woran erkennen Sie das?
In der Stimmbürgerschaft nehmen die wirtschaftlich-sozialen Konflikte zwischen Stadt und Land sowie zwischen Arbeit und Kapital stark zu. Gleichzeitig beobachten wir, dass trotz Konkordanz auch die Regierungsparteien bei diesen Konflikten im Abstimmungskampf immer seltener die gleiche Linie vertreten. Gaben die Regierungsparteien 1975 noch in vier von fünf Volksabstimmungen die gleiche Parole aus, findet sich dies heute nur in einer einzigen von fünf.
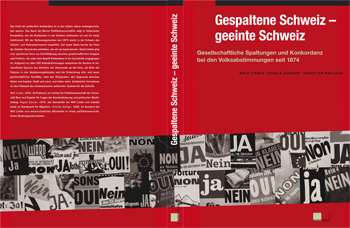
Spalten Abstimmungen die Stimmbürger oder führen sie das Volk zusammen? Das Buch liefert eine Analyse. (Bild: zvg)
Welche Rolle spielen dabei die zunehmende Polarisierung der Schweizer Politik und die Oppositionsrolle der SVP?
Neu ist, dass neben der SP auch die SVP häufig in der Oppositionsrolle zu finden ist. Dies spaltet in Volksabstimmungen das einst stabile bürgerliche Lager. In dieser verschärften Parteienkonkurrenz wird Konkordanz schwieriger.
Konkordanz bedeutet, dass Kompromisse zur «mittleren Unzufriedenheit» aller ausgehandelt werden. Wäre nicht eine politische Streitkultur wie in Deutschland im Endeffekt effizienter?
Es gibt Theoretiker, welche der Wettbewerbsdemokratie eine bessere Innovationskraft zubilligen als einer Verhandlungsdemokratie wie der Schweiz. Wir finden auch Schweizer Politiker, die sich dadurch klarere Verantwortlichkeiten und mehr politische Führung versprechen. Aber ein solcher Wechsel verlangt mehr als die Änderung des politischen Stils.
Woran denken Sie?
Die Volksrechte müssten eingeschränkt und die Ansprüche an die föderalistische Kantonsautonomie heruntergeschraubt werden. Dafür fände sich so schnell keine Mehrheit.
Ist die Konkordanz noch zeitgemäss?
In der Schweiz sprechen viele Gründe weiterhin für die Konkordanz: der Kooperationszwang der Volksrechte, die politische Stabilität oder die Bewahrung föderalistischer Vielfalt in einer Zeit, in welcher der Aussendruck durch die Globalisierung zunimmt. Zudem ist der politische Kompromiss mehr als die «mittlere Unzufriedenheit», nämlich die kreative Suche nach einer Sachlösung, in der es mehr Gewinner und weniger Verlierer gibt.