45-Sekunden-Video bringt Forschung auf den Punkt
Berge von Forschungsergebnissen – und niemand nimmt sie wahr. Um dies zu verhindern, regt das EU-Projekt «mountain.TRIP» mit Berner Beteiligung den Wissenstransfer in der Berggebietsforschung an.
Es wird lautstark diskutiert und wild gestikuliert: In Sighisoara, einer Kleinstadt in den rumänischen Karpaten, sitzen Schafzüchter und Bäuerinnen aus den Bergen in einem Raum zusammen und besprechen eine Broschüre, die für die landwirtschaftsnahen Produzenten verfasst wurde. Das Merkblatt fasst aktuelle Resultate der Forschung über Produktions- und Vermarktungsstrategien in Berggebieten für die lokale Bevölkerung zusammen. Mitten in diesem Getümmel ist auch Claudia Drexler, eine Mitarbeiterin des Geographischen Instituts der Uni Bern (GIUB). Aus dem rumänischen Wortschwall versucht sie einige unmittelbare Rückmeldungen zu erhalten, was dank der Übersetzung ihrer rumänischen Kollegin Catalina Munteanu tatsächlich gelingt. Ziel dieses Workshops in den Ostkarpaten ist es, vor Ort und direkt beim Zielpublikum Feedbacks zu den erarbeiteten Mitteln der Forschungskommunikation einzuholen.
Von der Theorie in die Praxis
Die Schnittstelle zwischen geographischer Forschung und Kommunikation ist der Arbeitsplatz von Claudia Drexler. Sie ist verantwortlich für die Entwicklung von Kommunikationsmitteln im EU-Projekt «mountain.TRIP», das jetzt nach einer zweijährigen Laufzeit abgeschlossen wurde. Ziel des internationalen Gemeinschaftsprojekts mit Berner Beteiligung war es, Lösungen für die Kommunikation von praxisrelevanten Forschungsergebnissen der Berggebietsforschung zu finden. «Ergebnisse von Forschungsarbeiten sind häufig nur ausgewählten wissenschaftlichen Kreisen zugänglich», erklärt Drexler. «Dabei ist es bei angewandten Forschungsprojekten wichtig, dass die Resultate am Schluss auch den Praktikerinnen und Praktikern zukommen.» Potentielle Interessierte für Ergebnisse der Berggebietsforschung seien etwa Raumplanungsämter in Bergregionen, Elektrizitätsgesellschaften, Bergbauernverbände oder zuständige Stellen der öffentlichen Hand. «Für die Experten ist es wichtig, dass sie ihre Vorhaben auf der neuesten wissenschaftlichen Basis abstützen können», so Drexler.
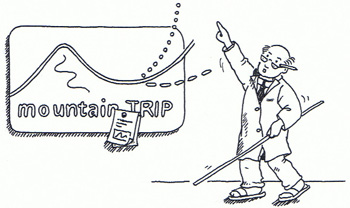
Forschende haben ein grosses Wissen...
Kommunikation ist häufig mangelhaft
Das Projekt mountain.TRIP – kurz für «Transforming Research Into Practice» – erfasste 110 berggebietsrelevante europäische Forschungsprojekte. Die Auswertung ergab, dass lediglich bei 50 Prozent überhaupt Resultate zu finden waren. Die Ergebnisse wurden in einem Grossteil der Projekte unverständlich oder unanwendbar kommuniziert. «So ist es extrem schwierig, relevante Forschungsergebnisse in der Praxis umzusetzen», bedauert die Berner Geographin. «Das vorhandene Wissen interessiert zwar die potentiellen Abnehmer, aber häufig funktioniert der Transfer nicht.»
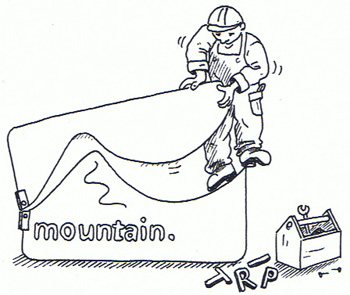
...doch in die Praxis umsetzen lässt sich Forschung nur, wenn richtig kommuniziert wird. (Illustrationen: Astrid Björnsen Gurung)
Konkrete Lösungen
Hier setzt mountain.TRIP an: Die Projektmitarbeiterinnen erarbeiteten einerseits verschiedene exemplarische Kommunikationsprodukte, die zeigen, wie Forschungsresultate effizient und verständlich vermittelt werden können – so geschehen bei der Broschüre für die Lebensmittelproduzenten in den rumänischen Karpaten. Aber auch im Bereich der elektronischen Medien bieten sich vielversprechende neue Möglichkeiten: «Wir haben informative Kurz-Videos produziert, die Essentielles prägnant auf den Punkt bringen», führt Claudia Drexler aus. Auch die Sozialen Medien vereinfachten den Dialog zwischen Wissenschaft und Praxis; diese neuen Kommunikationskanäle sollten auch in der Forschung vermehrt eingesetzt werden.
Andererseits erzeugte mountain.TRIP laut Drexler wichtige Resultate auch für die Forschenden selber: «Im Laufe des Projekts wurden verschiedene Anleitungen und Netzwerke aufgebaut, so etwa ein Handbuch, eine rege benütztes Online-Forum sowie ein Wiki, ein digitales Nachschlagewerk zur Forschungskommunikation.» Diese Hilfsmittel werden auch künftig auf dem neuesten Stand gehalten, denn sie weisen den Forschenden den Weg zu einem effizienten und verständlichen Wissenstransfer.