Letztes Funksignal von «Rosetta»
Die Raumsonde «Rosetta» verabschiedet sich: Um Energie zu sparen, schaltet sie sich für 32 Monate ab. Am Mittwoch, 8. Juni, schickt die Europäische Weltraumorganisation ESA das letzte Kommando an den Kometenjäger. Die Berner Weltraumforschenden fiebern mit.
Heikle Phase für die ESA-Kometenmission «Rosetta»: Am Mittwoch, 8. Juni 2011, versetzt sich die Raumsonde in einen zweieinhalbjährigen Tiefschlaf, wie die ESA mitteilt. Den Grund erklärt Kathrin Altwegg von der Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie des Physikalischen Instituts der Uni Bern: «Die Sonde hat sich nun so weit von der Sonne weg bewegt, dass die Solarenergie nur noch für die Heizung reicht.» Deshalb werden alle Forschungsgeräte und auch die Sonde selber abgeschaltet. Erst Anfang 2014 wird sich Rosetta über eine programmierte Software selber wecken – wenn sie sich aufgrund ihrer elipsenförmigen Umlaufbahn wieder der Sonne nähert. «Das Aufwach-Prozedere wurde einmal im All geprobt – und es hat einwandfrei funktioniert», so Altwegg.
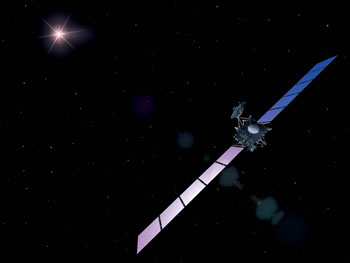
Auf einsamem Weg zum Rand des Sonnensystems: die Raumsonde «Rosetta». (Bild: ESA)
Kometen sind Fundgruben für Planetologen
Rosetta ist auf der Suche nach dem Ursprung des Alls: Proben des Kometen Churyumov-Gerasimenko, den die Sonde im Jahr 2014 nach einer 7,1 Milliarden Kilometer langen Reise erreichen wird, sollen Aufschluss über die Entstehung unseres Sonnensystems geben. Kometen sind sozusagen archäologische Fundgruben für die Weltraumforschenden: Aufgrund ihrer weiten Entfernung zur Sonne haben sie nämlich Material aus den Momenten des «Big Bang» tiefgefroren und damit bestens konserviert. Mit ihren 21 Instrumenten an Bord wollen die ESA-Forschenden das Urmaterial analysieren. Das Massenspektrometer «Rosina» von Altweggs Team wird zum Beispiel die chemischen Gase untersuchen.
Letzter Funk über 650 Millionen Kilometer
Am Mittwoch wird der letzte Funkkontakt zwischen Erde und Rosetta stattfinden – gemäss Mitteilung der Schweizerischen Depeschenagentur (sda) braucht das Funksignal aus dem Europäischen Raumfahrtkontrollzentrum ESOC in Darmstadt rund 29 Minuten, um die 654 Millionen Kilometer entfernte Sonde zu erreichen. Dann beginnt ein weiteres Abenteuer für die Mission, die schon einige Herauforderungen gemeistert hat: Auf ihrer Reise seit dem Start im Jahr 2004 in Französisch-Guayana hat Rosetta dreimal die Erde und einmal den Mars umkreist. Erst dieses planetarische Pingpong hat die Sonde genügend beschleunigt, um an den äusseren Rand des Sonnensystems zu fliegen. Vor drei Jahren hat Rosetta den Asteroiden «Steins», später im 2010 «Lutetia» passiert und eindrucksvolle Bilder geschossen.
Berner kalibrieren eifrig die Geräte
Über zwei Jahre Sendepause – und doch viel zu tun: «Wir nutzen die Zeit, um das Zwillingsgerät von Rosina, welches hier am Physikalischen Institut steht, zu kalibrieren», erklärt Kathrin Altwegg. Man wolle bestens für das Treffen mit dem Ziel-Kometen gerüstet sein. Ausserdem werden nun die Diskussionen der beteiligten Forschergruppen beginnen, wie die Raumsonde um Churyumov-Gerasimenko fliegen soll. Arbeit auf der Erde, die vom bangen Warten auf den 20. Januar 2014 ablenkt: Das ist der Tag, an dem sich Rosetta selber wecken und ihre Antenne wieder gegen die Erde ausrichten soll.