Die innere Uhr gibt den zeitlichen Takt vor
Menschen und Tiere messen die Zeit mit inneren Uhren und justieren diese anhand von äusseren Einflüssen wie Tag und Nacht. Dieser «zirkadiane Mechanismus» wurde bereits vor langer Zeit entdeckt, wie ein Vortrag der Reihe «Alles hat seine Zeit» des Collegium generale zeigte. Nun stellen sich aber neue Fragen, etwa welchen Einfluss die Klimaveränderung auf die biologische Uhr hat.
Sie sind bei fast allen Organismen zu finden – von der Alge bis zum Säugetier – und bestimmen deren Alltag: biologische Uhren. Diese werden definiert als selbsterhaltende innere Rhythmen, die durch körpereigene Uhrwerke gesteuert werden. Ein Beispiel dafür ist die Körpertemperatur des Menschen: Niedrig zu Beginn des Tages steigt sie bis abends kontinuierlich an, um dann langsam wieder abzunehmen, bis sie gegen Ende der Nacht ihren Tiefpunkt erreicht.
«Biologische Uhren sind erblich und funktionieren selbstständig, können aber von Aussenreizen beeinflusst werden», sagte Michaela Hau, Forscherin am Max-Planck-Institut für Ornithologie und Professorin an der Universität Konstanz. Sie sprach im Rahmen der aktuellen Vorlesungsreihe «Alles hat seine Zeit» des Collegium generale darüber, wie Mensch und Tier die Zeit messen.
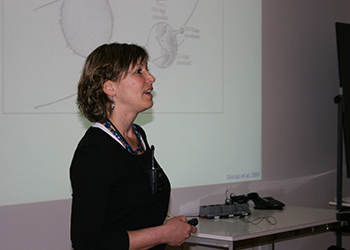
Unsere inneren Uhren funktionieren laut Ornithologin Michaela Hau selbstständig, werden aber durch Zeitgeber wie etwa Tag und Nacht beeinflusst. (Bild: Sandra Flückiger)
Die Sand- und Kuckucksuhren in uns
Organismen orientieren sich an verschiedenen Zyklen wie etwa den Jahreszeiten, Ebbe und Flut, Tag und Nacht. Wie genau können sie aber die Zeit messen? Laut Biologin Hau gibt es zwei Mechanismen: das Sanduhr-Prinzip und die mechanische Uhr. Bei Ersterem gibt es eine steigende Tendenz, ein Verhalten auszuführen – analog zum Sand, der durch die Sanduhr rieselt und unten einen immer grösseren Haufen bildet. Ist ein bestimmter Schwellenwert erreicht, wird das Verhalten ausgeführt und die Sanduhr umgedreht. Ein solcher kumulativer Prozess spiegelt sich in unserer Schlafsteuerung: «Während dem Tag nimmt das Wachbedürfnis ab und das Schlafbedürfnis zu – bis wir schlafen und sich der Prozess umkehrt», erläutert Hau.
Mechanische Chronometer wie etwa Kuckucks-Uhren dagegen funktionieren, indem das Verhalten durch ein Signal ausgelöst wird: Beispielsweise nimmt das Auge Licht wahr, und Nervenbahnen leiten die Information weiter, die auf bestimmte Gebiete im Gehirn wirken. «Dabei spricht man vom zirkadianen System», so Hau. Dieses bestehe aus vielen negativen und positiven Rückkoppelungsmechanismen auf molekularer Ebene und weise zahlreiche Redundanzen auf. «Wenn eine Komponente ausfällt, kann das System trotzdem aufrecht erhalten werden.»
Mensch hat einen Rhythmus von über 24 Stunden
Von der Wissenschaft wurden biologische Uhren früh entdeckt: 1729 beobachtete der Geophysiker Jean-Jacques D’Ortus de Mairan Blattbewegungen von Mimosen, die ihre Blätter in der Nacht schliessen. Diese Bewegungen führten sie auch aus, wenn sie nur im Dunkeln gehalten wurden. Das gleiche wurde rund 100 Jahre später bei Bohnenschösslingen festgestellt. «Zu dieser Zeit ging man davon aus, dass diese Uhr eine Art Lernen sei, kein selbstständiger Mechanismus», erklärt Michaela Hau. Erstmals von einer biologischen Uhr sprach 1952 der Ornithologe Gustav Kramer, der den Orientierungssinn von Brieftauben erforschte. Die moderne Chronobiologie wurde 1960 unter anderem von Jürgen Aschoff begründet.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Frühaufsteher werden Lerchen genannt und Nachtaktive mit einem späten Rhythmus als Eulen bezeichnet. (Bild: Wikimedia Commons)
Der deutsche Verhaltensphysiologe untersuchte den Einfluss von äusseren Reizen auf das zirkadiane System des Menschen, indem er seine Probanden einige Tage bis Wochen in einem abgeschotteten Bunker wohnen liess. Die Versuchspersonen lebten so ohne Kontakt zur Aussenwelt nach ihrem eigenen Rhythmus. Es zeigte sich, dass sie immer später aufstanden. «Die meisten Menschen haben eine Rhythmik von 24,1 bis 25,6 Stunden», so Hau. Dies belege, dass es keinen äusseren Rhythmus gebe, da die Unterschiede sonst nicht so gross ausfallen würden. Die Individualität der inneren Uhren beim Menschen zeige sich ausserdem beim Chronotypen: Die Einen sind Frühaufsteher – Lerchen genannt – andere dagegen nachaktiv, wie Eulen.
Tag und Nacht ist der wichtigste Zeitgeber
Die inneren Uhren laufen also frei – sind aber verstellbar: «Bei einem Experiment mit Spatzen haben wir den Tag acht Stunden früher beginnen lassen. Die Vögel konnten sich darauf einstellen, brauchten aber einige Tage dafür», sagt die Ornithologin. Für sie seien nicht nur Tag und Nacht wichtige Zeitgeber, sondern auch Futtermöglichkeiten und paarungsbereite Artgenossen.
Biologische Uhren seien ausserdem artspezifisch. Dies zeige sich beispielsweise bei Blumen, die ihre Blüten zu verschiedenen Tageszeiten öffneten – abhängig davon, welche Temperatur und Sonneneinstrahlung ideal für die Nektarproduktion sei. Honigbienen wiederum benutzen ihre innere Uhr für die optimale Futtersuche: «Sie haben ein ausgezeichnetes Zeitgedächtnis und fliegen genau dann zu einer Blume, wenn sie den zuckerreichsten Nektar hat.»
Menschen orientieren sich hauptsächlich am Licht-Dunkel-Wechsel. Damit justieren wir unsere innere Uhr und brauchen uns daher keine Sorgen darüber zu machen, dass unser Rhythmus nicht genau 24 Stunden entspricht. Allerdings, so Michaela Hau, stellten sich zunehmend wichtige Fragen, welche die Forschung angehen müsse: Wie beeinflussen der moderne Lebensstil und die hohe Lichtverschmutzung die biologischen Rhythmen der Menschen? Und welche Auswirkungen haben Umwelt- und Klimaveränderungen?