«Demut im Sieg, Grösse in der Niederlage»
Schwingen steht im Spannungsfeld zwischen traditionellem Kulturgut und Spitzensport. Im Rahmen der «Berner Gespräche zur Sportwissenschaft» haben der Schwingerkönig 2016 Matthias Glarner und der SRF-Kommentator Stefan Hofmänner die aktuellen Entwicklungen im Schwingsport diskutiert. Glarner, der an der Universität Bern Sportwissenschaft studiert hat, gewährte dabei auch Einblicke in sein Leben als Spitzensportler.
Schwingen hat sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt und hat den Anspruch, einerseits Schweizer Kulturgut und andererseits moderner Spitzensport zu sein. So ist der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) Mitglied der Interessengemeinschaft Volkskultur Schweiz und setzt sich in diesem Zusammenhang für den Erhalt kultureller Traditionen und für die Bewahrung gesellschaftlicher Werte ein. Der ESV ist seit Anfang 2017 aber auch Mitglied bei SwissOlympic und hat sich hinsichtlich Medienpräsenz und Attraktivität für Sponsoren zu einem modernen professionellen Sportverband entwickelt. Dieses Spannungsfeld stellte die Ausgangslage für das Gespräch zwischen Matthias Glarner und Stefan Hofmänner dar.
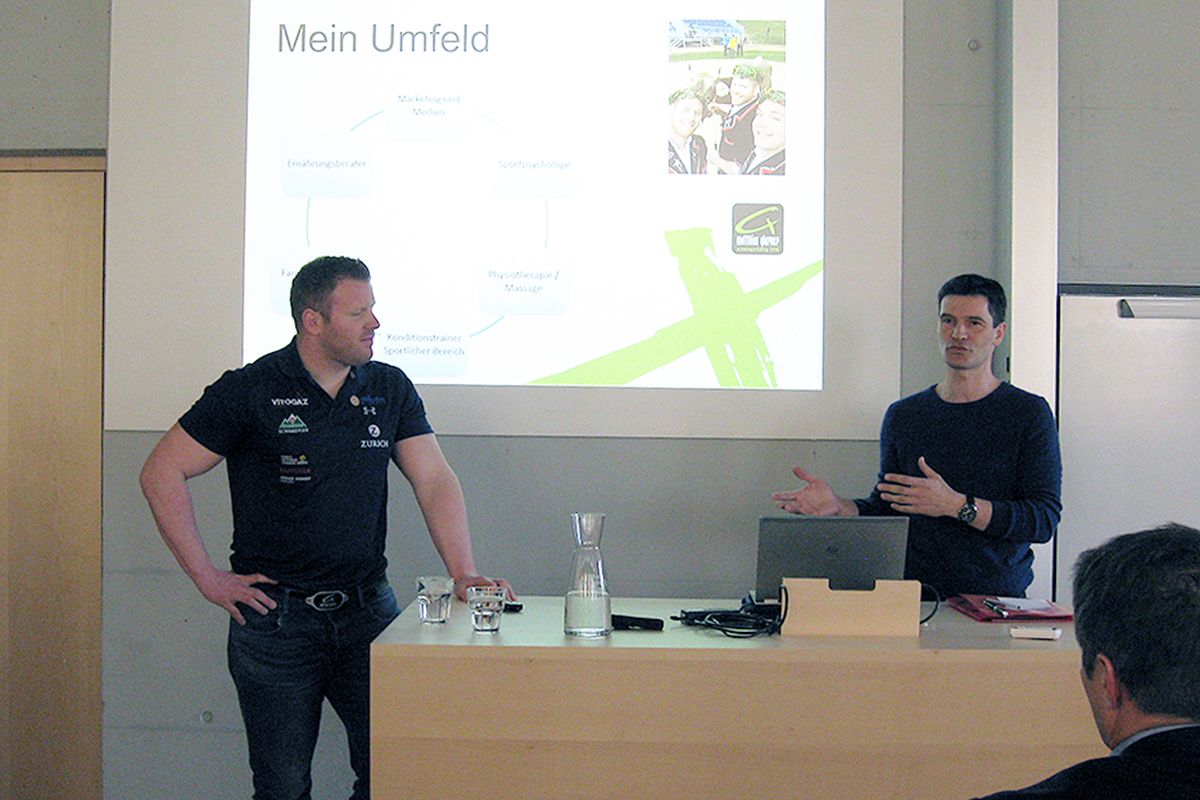
Hofmänner thematisierte im Gespräch mit Glarner vier verschiedene Aspekte des Schwingens: das Schwingen als Sport, das Amateur-Dasein der Schwinger, Marketingaktivitäten und Sponsoring im Schwingen und die Erholung eines Spitzenschwingers. Und er fragte bei Glarner nach, was ihn motiviert, seine Karriere um weitere drei Jahre fortzusetzen.
Der Schwinger als Sportler mit Tradition
Zu den sportlichen Aspekten des Schwingens gehören unter anderem die Schwingtechnik, die Muskelkraft, der Saisonaufbau und das Training. Ebenso wichtig sind aber auch Brauchtum und Tradition: «Für mich war klar, dass ich nicht im Kühermutz zu diesem Gespräch erscheine, weil diese Tracht reserviert ist für festliche Angelegenheiten wie beispielsweise die Kranzübergabe am Schwingfest», betonte Glarner.

Es wird angenommen, dass der Schwingsport seit dem 13. Jahrhundert ausgeübt wird. Viele traditionsreiche Bräuche werden nach wie vor praktiziert. So ist es Usus, dass der Gewinner eines Schwingkampfes nicht zu stark jubelt, getreu dem Motto «Demut im Sieg». Demgegenüber steht «Grösse in der Niederlage», also, dass sich der Verlierer nicht allzu deprimiert zeigt, wenn er vom Platz geht. Glarner bestätigte: «Diese Werte gehören zum Schwingsport. Die älteren Schwinger geben diese an die jüngeren im Schwingklub von Beginn weg weiter.» Für Glarner kamen diese Schwinger-Werte auch auf dem Weg zum und beim Eidgenössischen Schwingfest und insbesondere beim Sieg im Schlussgang zum Tragen: «Ich hatte mich lange und intensiv darauf vorbereitet und es war mir wichtig, auch die Leistung meines Gegners zu würdigen.»
Das Amateur-Dasein eines Schwingers
Da Schwinger Amateur-Sportler sind, arbeiten sie neben ihrer sportlichen Karriere. Ein Spitzenschwinger wie Glarner trainiert durchschnittlich 14 bis 16 Stunden pro Woche, wobei nur etwa drei bis viermal pro Woche effektiv geschwungen wird, da dieses spezifische Training eine hohe körperliche Belastung darstellt. Daneben arbeitet Glarner 60% bei den Bergbahnen Meiringen-Hasliberg, wobei er im Winter mehr Zeit bei der Arbeit verbringt, so dass er sich im Sommer mit reduziertem Arbeitspensum mehr auf das Schwingen konzentrieren kann. Für ihn stellt die Arbeit nicht etwa eine Doppelbelastung, sondern einen guten Ausgleich zum Schwingen dar. Wie Glarner sagte, sei auch das Wissen, das er während des sportwissenschaftlichen Studiums an der Universität Bern erworben hat, ein wichtiger Baustein für seine sportlichen Erfolge.

Der Schwinger als attraktiver Werbeträger
Die puristischen Freunde des Schwingsports sind der Meinung, dass sich der Schwingsport auf einem absteigenden Ast befindet, seit Manager in diesem Bereich Einzug gehalten haben. Glarner hat einen Marketingverantwortlichen, den er bereits lange kennt und der selbst eng mit dem Schwingsport verbunden ist und der die Schwinger-Werte kennt. Er schätze es, dass er keine Manager-Sportler-Beziehung, sondern eine freundschaftliche Beziehung zu seinem Marketingverantwortlichen pflege. Als Schwingerkönig ist Glarner natürlich attraktiv für Sponsoren und die Werbung: «Wichtig ist mir, dass ich mit Werbeauftritten und Sponsoringaktivitäten immer auch die Werte des Schwingens in die Öffentlichkeit tragen und Werbung für den Schwingsport machen kann.» Die Leidenschaft für den Sport sei der ausschlaggebende Grund, dass Glarner seine Karriere für drei Jahre fortsetzt. Würden monetäre Aspekte im Vordergrund stehen, so wäre dies die falsche Motivation und auch der Erfolg würde darunter leiden, zeigte sich Glarner überzeugt.
Der Eidgenössische Schwingerverband setzt sich gegen Korruption ein und dafür, dass Sponsorenengagements mit den Schwinger-Werten übereinstimmen. So soll auch aus Sicht von Glarner das Schwingerhemd und die Arena weiterhin werbefrei bleiben.
Ein weiterer Schritt in Richtung Professionalisierung ist mit dem Beitritt des ESV zu SwissOlympic geschehen. Dadurch hat sich unter anderem das Vorgehen bei Dopingkontrollen verändert: Die Durchführung solcher Kontrollen konnte vom Verband getrennt und an SwissOlympic bzw. Antidoping Schweiz übergeben werden.

Der Schwinger und die Kunst, sich abzugrenzen
Training, Arbeiten und Wettkämpfe – wann erholt sich ein Schwinger? Für Glarner wird dies ein zentrales Thema in den nächsten 3 Jahren sein, denn jeder Termin geht zu Lasten der Freizeit. Glarner: «Mann muss für sich selbst Grenzen ziehen. So habe ich beschlossen, meinen Fokus auf zwei bis drei Schwingfeste pro Jahr zu legen.»
Zu den Personen

Matthias Glarner, Jahrgang 1985, wurde in Meiringen geboren und ist dort in einem polysportiven Umfeld aufgewachsen. Nach der Ausbildung zum Polymechaniker mit Berufsmatura bei den SBB hat er durch die Passerelle Zugang zum Universitätsstudium erlangt und hat Sportwissenschaft studiert. Heute ist er als Personalcoach bei den Bergbahnen Meiringen Hasliberg tätig. Mit dem Schwingen hat Glarner 1994 begonnen und hat seine Schwingerkarriere ab 2002 aktiv vorangetrieben. Vorläufiger Höhepunkt der Sportlaufbahn war der Gewinn des Königstitels 2016 in Estavayer.

Stefan Hofmänner, Jahrgang 1966, wurde in Bern geboren und ist in Kehrsatz aufgewachsen. Er war 1988 bis 1900 als Lehrer in Steffisburg tätig und hat danach die Turnlehrerausbildung an der Universität Bern absolviert. Hofmänner ist seit 1997 beim Schweizer Fernsehen als Sportredaktor mit breitem Sportartenfächer tätig. Aktuelle Arbeitsfelder bei SRF Sport: Beitragsmacher, Sendungsproduzent, Livekommentator der Sportarten Kunstturnen, Schwingen und Ski/Snowboard Freestyle.
Das Institut für Sportwissenschaft
Das Institut für Sportwissenschaft zeichnet sich in Lehre und Forschung durch seine integrative und anwendungsorientierte Ausrichtung mit sozial- und verhaltenswissenschaftlicher Schwerpunktlegung aus.
In der Lehre wird auf eine ausgeprägte Vernetzung zwischen theoretischen und sportpraktisch-methodischen Veranstaltungen Wert gelegt.
In der Forschung wird eine problemorientierte Strategie verfolgt, die sich auf Phänomene des Sports in seiner ganzen Breite richtet und deren Umsetzung durch exzellente personelle wie apparative Forschungsmöglichkeiten unterstützt wird. Der sportwissenschaftliche Austausch wird zudem durch das vom Institut veranstaltete interdisziplinäre Kolloquium «Berner Gespräche zur Sportwissenschaft» gefördert.
Zur Autorin
Rahel Spring ist als Beauftragte Öffentlichkeitsarbeit am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern tätig.