Dank Forschungspartnerschaften
Bessere Behandlungen für alle
Dass es der medizinischen Versorgung Afrikas schon beim Grundlagenwissen mangelt, wird der Forschungscommunity erst langsam bewusst. Die Universität Bern trägt dazu bei, das Manko zu beheben – für den Süden und den Norden.

Man kann es so oder so sehen: Afrika, ein blinder Fleck auf der medizinischen Landkarte, ein vernachlässigter, vergessener Kontinent. Oder aber: Afrika, ein ungehobener Schatz an Genvarianten und medizinisch relevanten Daten. Die Zahlen sprechen für sich: Rund 18 Prozent der Weltbevölkerung leben in Afrika, aber nur schätzungsweise etwas über 2 Prozent aller klinischen Studien werden auf dem Kontinent durchgeführt. Dasselbe Bild beim menschlichen Genom: «Als das Genom sequenziert war, feierte man das als grosse wissenschaftliche Errungenschaft – dabei ist das, was man da herausgefunden hat, überhaupt nicht repräsentativ für die Weltbevölkerung», sagt Carmen Faso vom Institut für Zellbiologie und vom Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern. Das medizinisch-genetische Wissen basiere letztlich auf weissen, männlichen Versuchspersonen.
Medizin für alle Ethnien und Geschlechter
Dass die medizinische Forschung manch einen blinden Fleck auf der Gender-Landkarte hat und Frauen deshalb buchstäblich schlechter behandelt werden, ist häufiger ein Thema, auch in den Medien. Dass dasselbe für ethnische Diversität gilt, dämmert der medizinischen Community erst langsam. Aber: «Es gibt da gerade einen ziemlichen Shift», ist Faso überzeugt. Auch die Universität Bern ist daran beteiligt, es gibt zahlreiche Partnerschaften mit afrikanischen Universitäten. Mit der Initiative Afrique setzt die Uni nun einen neuen Schwerpunkt im Nord-Süd-Verbund, mit dem die Expertise gebündelt und die Vernetzung gefördert werden. Die Internationalisierungsstrategie der Uni basiere auf «der festen Überzeugung, dass die Bewältigung globaler Probleme eine globale Zusammenarbeit erfordert», wie es Hugues Abriel formuliert, Gruppenleiter am Institut für Biochemie und molekulare Medizin sowie Vizerektor Forschung und Innovation.
Zu Abriels Team gehören auch Nada El Makhzen und Michèle Fuhrer, die sich zusammen in ein sehr emotionales Forschungsabenteuer gestürzt haben. Die beiden Doktorandinnen sind spezialisiert auf zystische Fibrose (CF) – eine Krankheit, die sich in übermässiger Schleimproduktion äussert und die Lunge und die Verdauungsorgane beeinträchtigt. Einmal diagnostiziert, ist CF eigentlich gut behandelbar. Sieht man sich die Fallzahlen an, scheint zystische Fibrose in Afrika kaum ein Problem zu sein. Aber das täuscht. El Makhzen sagt, zystische Fibrose gelte nach wie vor als «europäische Krankheit», und das nicht etwa, weil Menschen in Afrika davor gefeit wären, sondern schlicht, weil es keine Daten zu afrikanischen Patientinnen und Patienten gebe. Aufmerksam auf diesen Missstand sei Abriel bei einem Sabbatical in Fez, Marokko, geworden. Hierzulande steht in jedem Spital ein CF-Testgerät, mit dem der Schweiss von Kindern für eine rasche Erstdiagnose untersucht werden kann. Kosten der Gerätebeschaffung: rund 10 000 Franken. In Afrika sucht man solche Geräte meist vergebens. Und längst nicht alle Familien in Marokko können sich eine Reise nach Casablanca leisten, wo man zu einer Diagnose käme. Stattdessen werde CF häufig fehldiagnostiziert, denn die Symptome seien ähnlich wie bei Unterernährung, sagt Fuhrer.
Zur Person

Nada El Makhzen
ist PhD-Studentin am Institut für Biochemie und Molekulare Medizin (IBMM) der Universität Bern.
Erfolgreiches Crowdfunding
Also lancierten die beiden Doktorandinnen kurzerhand eine Crowdfunding-Kampagne, um ein CF-Testgerät für ein Spital im marokkanischen Fez zu beschaffen. Die Kampagne war unerwartet erfolgreich, bald kam ein weiteres Gerät für Kinshasa (Demokratische Republik Kongo) dazu. Aber noch ist das natürlich bloss ein Tropfen auf den heissen Stein, insbesondere wenn man sich die afrikanische Realität vor Augen hält, wie Fuhrer erklärt: CF sei bloss eine von Tausenden von seltenen Krankheiten, die in Afrika meist undiagnostiziert bleiben, das hätten Studien in den letzten Jahren verschiedentlich aufgezeigt.
Aber bessere Diagnostik ist nur der Anfang, die beiden jungen Forscherinnen haben auch mögliche Behandlungen im Blick. Dazu brauche es auch Gensequenzierungen, sagt El Makhzen, um insbesondere die Varianten des CFTR-Gens zu bestimmen, die zu CF führen. Es sei bei CF von entscheidender Bedeutung, die Behandlung auf das genetische Profil der betroffenen Kinder abzustimmen. Ziel sei es daher, neue CFTR-Varianten in der marokkanischen Bevölkerung zu entdecken. Kennt man die Genlandschaft besser, dann kann man auch spezifischer helfen, denn die entsprechenden Medikamente seien mit grosser Wahrscheinlichkeit schon verfügbar, sagt Fuhrer.

Grosse Aufgaben, die mit Crowdfunding-Budgets kaum zu stemmen sein werden. Es sei ihnen bewusst, dass sie bloss einen kleinen ersten Schritt gemacht hätten – man dürfe aber auch nicht vergessen, dass Crowdfunding-Kampagnen wertvoll seien, um Aufmerksamkeit auf ein Problem zu lenken. «Wir denken viel grösser, auf jeden Fall», sagt Nada El Makhzen. Ziel ist das Rekrutieren weiterer junger Patientinnen und Patienten für eine umfassende Kohortenstudie. Dies, um überhaupt einmal einschätzen zu können, wie sich die CF-Lage in Marokko und anderen afrikanischen Ländern präsentiert. Als Nächstes dann steht die Entwicklung eines optimierten Diagnoseprotokolls für CF auf dem Plan, das in verschiedenen afrikanischen Ländern angewendet werden kann.
Zur Person

Michèle Fuhrer
ist MD-Studentin am Institut für Biochemie und Molekulare Medizin (IBMM) der Universität Bern.
Ziel: 10 000 Doktorierende
Gross denkt man auch bei der Initiative Afrique. Faso verantwortet den Cluster of Research Excellence (CoRE) namens «Genomics for Health Africa», zusammen mit einer Reihe von Partnerunis in Afrika und Europa. Diese von einem internationalen Konsortium lancierten Cluster, von denen bereits 17 laufen, basieren grundlegend auf Chancengleichheit zwischen Nord und Süd, auf einer kollaborativen Forschung ohne Hierarchien also. Faso sagt, mit dem Modell überwinde man endlich das Paradigma des «white saviorism», des «Rettergedankens», der viel zu lange die Zusammenarbeit mit Afrika geprägt hat. In den Clustern werde auf Augenhöhe zusammengearbeitet, Europa lerne von Afrika und umgekehrt. «Viele Forschende in Afrika sind Exkolleginnen und -kollegen und haben ihr Know-how an europäischen Universitäten erworben. Nun setzen sie es in ihren Heimatländern ein», sagt Faso. Das ehrgeizige Ziel: 10 000 PhDs auszubilden, die letztlich an afrikanischen Unis forschen sollen.
«Der globale Norden ist abhängig davon, dass es dem globalen Süden gut geht.»
Carmen Faso
Der von Faso verantwortete Cluster will die genetische Datenlage im Zusammenhang mit Infektions- und seltenen Krankheiten verbessern. Man stelle sich Eltern eines von einer seltenen Krankheit betroffenen Kindes in Europa vor: Hier gäbe es eine Vielzahl von Spezialistinnen und Spezialisten, die den Eltern zur Seite stehen würden, um eine geeignete Behandlung zu finden. Ganz anders bei einer Mutter von fünf Kindern in einem Shantytown in Südafrika: Genau ein Spital im ganzen Land verfüge über die entsprechende Expertise. In ganz Afrika seien es gerade mal fünf. Es ist offensichtlich, dass bei so wenigen Fachleuten auch das genetische Grundlagenwissen mehr als lückenhaft ist.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
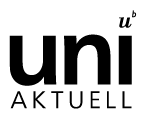
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Wertvolle Patientendaten im globalen Süden
Problematisch ist dieses Nichtwissen nicht nur für Afrika, sondern auch für den globalen Norden. In den USA zum Beispiel haben 84 Prozent der Patientinnen und Patienten, die an klinischen Studien teilnehmen, einen kaukasischen Hintergrund. Hingegen haben weniger als 3 Prozent einen lateinamerikanischen Hintergrund. Initiativen, die für mehr Diversität in klinischen und in Genomstudien sorgen möchten, scheitern oft an sozioökonomischen Hindernissen. Die Situation hat sich über die letzten Jahrzehnte kaum verbessert. Deshalb setzen Fachleute grosse Hoffnungen in den noch kaum genutzten Patientenpool in Afrika. Medizinische Produkte, die sich aufgrund dieser Patientendaten entwickeln lassen, können auch dem Westen dienen. «Man darf nicht vergessen, dass sehr viele von uns zumindest zum Teil einen Migrationshintergrund haben», sagt Faso. Das zeige sich auch in unseren genetischen Dispositionen.
Zur Person

Prof. Dr. Carmen Faso
ist Co-Direktorin des Multidisciplinary Center for Infectious Diseases (MCID) der Universität Bern und Co-Leiterin Cluster of Research Excellence (CoRE) «Genomics for Health Africa». Sie ist auch Gruppenleiterin am Institut für Zellbiologie und Institut für Infektionskrankheiten der Universität Bern.
Faso ist aber überzeugt, dass das Problem noch eine Schuhnummer grösser ist: Seien es Migrationsströme, seien es politische Unruhen: Wir im globalen Norden müssten das allergrösste Interesse daran haben, die medizinische Situation in Afrika ernst zu nehmen und zu verbessern. «Der globale Norden ist abhängig davon, dass es dem globalen Süden gut geht», so Faso: «Und wenn wir fragen, ob es jemandem gut geht, dann meinen wir eben nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern ganz grundlegend die Gesundheit.»
Veranstaltungshinweis
Collegium generale
Die Vielfalt von Afrika steht im Zentrum der Ringvorlesung des Collegium generale im Herbstsemester 2024. Von den 14 öffentlichen Vorträgen befassen sich 2 mit medizinischen Themen:
23. Oktober
Breaking Barriers: The Transplantation Journey for HIV Positive Individuals
Prof. Dr. Elmi Muller, Transplant Medicine, Stellenbosch University, South Africa
4. Dezember
Genomics for Health in Africa: How Can Medical Genomics Contribute?
Prof. Dr. Shahida Moosa, Molecular Biology and Human Genetics, Stellenbosch University, South Africa
Das ganze Programm und Veranstaltungsdetails finden Sie unter collegiumgenerale.unibe.ch.
Magazin uniFOKUS
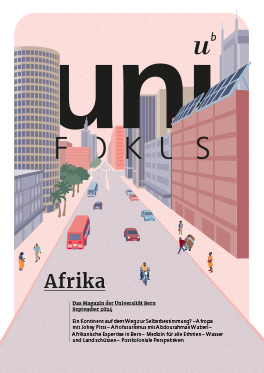
«Afrika»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Afrika»
uniFOKUS als Magazin abonnieren
