Aktionstage Behindertenrechte
«Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht auf Bildung»
Vor zehn Jahren hat die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Doch bei der Umsetzung bleibt viel zu tun, sagen Seraina Wepfer von der Abteilung für Chancengleichheit und Silvio Koelbing von der Kantonalen Behindertenkonferenz.

Silvio Koelbing: Die Aktionstage sind eine Art Jubiläum: In der Schweiz gibt es das Behindertengleichstellungsgesetz seit 20 Jahren. Und vor zehn Jahren wurde die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das Ziel der Aktionstage ist, die Bevölkerung für Behindertenrechte zu sensibilisieren und der Umsetzung der Rechte Schub zu verleihen. Die ersten Aktionstage haben 2022 in Zürich stattgefunden. Sie waren sehr erfolgreich, deshalb führen wir sie jetzt in der ganzen Schweiz durch. Wir machen dabei auf ein Grundprinzip aufmerksam: Menschen mit Behinderung haben die gleichen Menschenrechte wie alle anderen auch. Um ihnen zu ermöglichen, diese Rechte wahrzunehmen, müssen Bund, Kantone, Gemeinden sowie weitere Akteure Massnahmen ergreifen.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
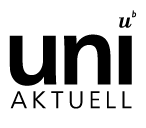
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Seraina Wepfer: Statistisch gesehen sind in der Bevölkerung rund 20 Prozent der Menschen von einer Behinderung betroffen, an den Hochschulen geht man von etwas mehr als zehn Prozent aus. Mit den Aktionstagen möchten wir das Thema an der Uni sichtbarer machen. Im Rahmen der Aktionstage Behindertenrechte hat zum Beispiel die Organisation Sensability Rundgänge mit Dunkelbrille und Blindenstock durchgeführt, bei denen man von Betroffenen geleitet selber erfahren konnte, was es an der Uni Bern braucht, um sich zurechtzufinden, wenn man nichts sieht. Wir haben auch ein Gastreferat zum Thema Autismus im Hochschulalltag sowie ein Podiumsgespräch mit Studierenden zum Thema Neurodivergenz durchgeführt, das von den beiden Macherinnen des Podcasts «IRRSINNIG» moderiert wurde. Ausserdem erscheint jede Woche ein neuer Audiobeitrag mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen zum Thema inklusive Perspektiven.
Zur Person

Seraina Wepfer
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Chancengleichheit der Universität Bern. Sie ist insbesondere zuständig für die Themen Behinderungen, chronische Krankheiten und psychische Gesundheit. Die Abteilung für Chancengleichheit ist Ansprechstelle für diese Themen und bietet Beratungen für Mitarbeitende und Studierende.
Silvio Koelbing: Grundsätzlich habe ich mein Philosophiestudium positiv erlebt. Ich habe aufgrund meiner Behinderungen – eine leichte Zerebralparese und neurodivergente Merkmale – Eingliederungsmassnahmen der IV wie zum Beispiel ein persönliches Coaching beansprucht, das sehr hilfreich war. Wie auch andere neurodivergente Menschen habe ich Konzentrationsschwierigkeiten, wenn es sehr lärmig ist. Deshalb wären mehr reizarme Lern- und Rückzugsorte direkt an der Uni aus meiner Sicht sehr sinnvoll. Ich habe mich oft zuhause auf die Vorlesungen vorbereitet. Rückblickend wäre es toll gewesen, öfters an der Uni lernen und mehr sozialen Austausch haben zu können.
Gab es auch andere Herausforderungen?Silvio Koelbing: Ich hatte während dem Studium den Eindruck, dass Pausen bei neurotypischen Menschen oft unpopulär sind. Viele bevorzugen es, durchzumachen und dafür früher fertig zu sein. Neurodivergente Menschen sind jedoch auf Pausen angewiesen. Allerdings ist es nicht immer einfach, das den 20 anderen Menschen im Raum zu erklären. Deshalb habe ich während dem Studium oft darauf verzichtet, Pausen mit Nachdruck einzufordern. Jetzt im Beruf bestehe ich eher auf Pausen an Sitzungen oder Versammlungen, aber das liegt auch daran, dass wir gehörlose Menschen und Dolmetschende in Gebärdensprache dabeihaben, die ebenfalls Pausen brauchen.
Neurodiversität
Neurodiversität bezeichnet die Vielfalt menschlicher Gehirne und ihrer Funktionsweise. Dazu gehören neurologische Besonderheiten wie Autismus, ADHS und Legasthenie. Menschen mit diesen Besonderheiten werden als neurodivergent bezeichnet. Im Gegensatz dazu stehen neurotypische Menschen, deren neurologische Entwicklung und Verhaltensweisen den gesellschaftlichen Normen entsprechen.
Seraina Wepfer:Völlig ausgleichen lässt sich eine Benachteiligung nur sehr selten. Aber wir setzen verschiedene strukturelle und individuelle Massnahmen um, um ein chancengleiches Studium und Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Auf individueller Ebene gibt es etwa den Nachteilsausgleich. Das ist ein Recht, das sich aus dem Behindertengleichstellungsgesetz ableitet. So einen Ausgleich kann man beantragen. Oft kommt es dann zu Prüfungsanpassungen, zum Beispiel hat man etwas mehr Zeit bis zur Abgabe. Oder man schreibt die Prüfung getrennt von den vielen anderen Studierenden in einem separaten Raum.
Gibt es auch Fälle, in denen ein Nachteilsausgleich nicht gewährt wird?Seraina Wepfer: Ja. Es gibt verschiedene Gründe, wieso ein Gesuch abgelehnt wird. Manchmal liegt es nur daran, dass die Beantragungsfrist nicht eingehalten wird. Oft geht es um Fragen der Machbarkeit und der Verhältnismässigkeit. Dann versuchen wir zu vermitteln, um gemeinsam mit allen Betroffenen gangbare Lösungen zu finden. Die Universität kann zum Beispiel bei grossen Vorlesungen nicht fünf separate Prüfungsräume zur Verfügung stellen. Und die fünf Betroffenen müssen in den gleichen separaten Raum.
Zur Person:

Silvio Koelbing
ist ehemaliger Student der Universität Bern, organisiert die kantonale Behindertenrechtskonferenz sowie die Aktionstage Behindertenrechte im Kanton Bern.
Silvio Koelbing: Ich denke, die Sensibilität in der Bevölkerung hat in den letzten Jahren schon zugenommen. Aber bei der Umsetzung, die regelmässig überprüft wird, schneidet die Schweiz nicht supergut ab. Im Artikel 24 der Konvention geht es um das Recht auf Bildung. Es gilt als eines der wichtigsten Menschenrechte, weil es den Zugang zu sehr vielem ermöglicht, zum Beispiel zu einer Stelle auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die zentrale Frage ist: Steht allen in der Schweiz, die studieren könnten und das auch möchten, der Weg an die Hochschulen offen? Oder mangelt es – nicht nur an den Hochschulen, sondern auf allen Ebenen des Schulsystems – an Ressourcen für die inklusive Bildung? Und passiert es deshalb vielleicht immer noch zu oft, dass Personen in der Sonderbeschulung landen, für die bei genauerem Hinsehen andere Lösungen gefunden werden könnten?
«Die zentrale Frage ist: Steht allen in der Schweiz, die studieren könnten und das auch möchten, der Weg an die Hochschulen offen?»
Silvio Koelbing
Seraina Wepfer: Die Behindertenrechtskonvention hat auch dazu geführt, dass sich die Definition der Behinderung gewandelt hat. Früher herrschte ein medizinisches Bild, das auf die Einzelperson und medizinische Massnahmen fokussiert war. Im heutigen Menschenrechtsmodell wird Behinderung als grundlegender Teil menschlicher Vielfalt definiert. Und neben individuellen Aspekten gelangen zusehends Umweltaspekte und das Recht auf Selbstbestimmung in den Fokus. Eine Person im Rollstuhl kann keine Treppen steigen, aber wenn neben der Treppe eine Rampe stehen würde, käme sie trotzdem hoch.
Was hat die Universität Bern auf dem Weg zur inklusiven Hochschule schon erreicht? Und was muss noch passieren, damit sie sich diesem Ideal weiter nähert?Seraina Wepfer: Es ist schon viel geschehen, gleichzeitig bleibt aber auch noch sehr viel zu tun. Das fängt bei der Sensibilisierung an, geht über die Infrastruktur – online wie offline –, bis zu individuellen Massnahmen wie dem Nachteilsausgleich und zur Lehre: Gerade Dozierende haben für Studierende eine sehr wichtige Rolle. Wir bieten dieses Jahr erstmals einen Kurs in inklusiver Lehre an, der von selbstbetroffenen Expertinnen und Experten geleitet wird.
«Dozierende spielen eine wichtige Rolle, deshalb bieten wir dieses Jahr erstmals auch einen Kurs in inklusiver Lehre an, der von selbstbetroffenen Expertinnen und Experten geleitet wird.»
Seraina Wepfer
Was wird bei diesem Kurs zur inklusiven Lehre vermittelt?Seraina Wepfer: Der Kurs gibt einerseits einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen sowie über die Prinzipien der Inklusion in der Hochschulbildung. Andererseits behandelt er auch ganz konkrete Anwendungsbeispiele, etwa wie man ein barrierefreies Dokument erstellt. Der Kurs ist freiwillig. Und ich hoffe, er wird gut besucht. Das würde mich natürlich freuen.
Gibt es auch Widerstände?Seraina Wepfer: Ja, meiner Erfahrung nach hat der Widerstand oft mit fehlender Sensibilisierung zu tun. Ich beobachte auch einen Unterschied zwischen den Reaktionen auf sichtbare und unsichtbare Behinderungen. Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen – also zum Beispiel Menschen aus dem neurodivergenten Spektrum – schlägt oft Unverständnis entgegen. Einige Dozierende finden es beispielsweise mühsam, ihren Unterricht anpassen zu müssen. Sie fragen ganz grundsätzlich, ob Menschen mit bestimmten Behinderungen überhaupt studierfähig sind. Aber meiner Meinung nach liegt es nicht an uns, die Studierfähigkeit einer Person in Frage zu stellen. Wenn sie die Matura gemacht hat, hat sie den Ausweis, um an einer Universität zu studieren. Ihr dieses Recht zu verweigern, ist diskriminierend.
Silvio Koelbing: Einverstanden. Im Internet kursieren manchmal Totschlagargumente gegen Inklusion, wie dass Blinde nicht Flugzeugpiloten werden können. Natürlich kann nicht jede Person alles machen. Aber trotzdem können Menschen mit Behinderungen Fähigkeiten entwickeln und Leistungen erbringen. Nur wird das vielen gar nicht erst zugetraut.


