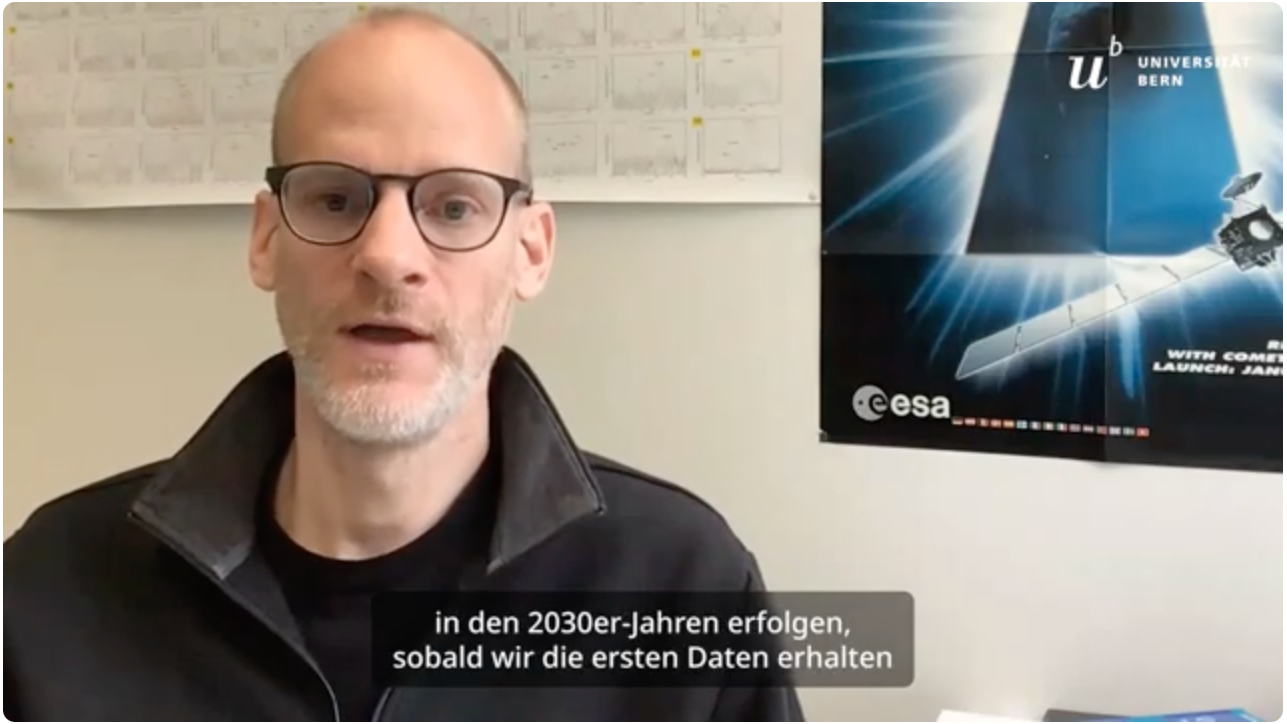Beteiligung an ESA-Mission
Kometenforschung mit Berner Instrumenten
Die Universität Bern steuert zwei Instrumente zur Comet Interceptor Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA bei, die 2029 zu einem Kometen aufbrechen soll. Martin Rubin erklärt die Bedeutung dieser Mission für das Verständnis unseres Ursprungs.
Was versuchen Sie herauszufinden, Martin Rubin?
Martin Rubin: In meiner Forschung geht es um Kometen. Einen solchen wollen wir mit der Mission Comet Interceptor der Europäische Weltraumagentur ESA besuchen. Ein internationales Konsortium entwickelt dafür in den nächsten zwei Jahren die Hauptkamera CoCa unter der Leitung von Nicolas Thomas von der Uni Bern und das Massenspektrometer MANiaC unter meiner Leitung. Der Start der Mission ist für 2029 geplant. Die Analyse der Messungen wird in den 2030er Jahren erfolgen, sobald wir die ersten Daten erhalten haben. Dabei interessiert mich hauptsächlich die Zusammensetzung der Kometen. Nebst Staub und organischem Material bestehen diese aus vielen verschiedenen Arten von Eis. Aus diesem Material entstehen dann auch die bekannten Schweife der Kometen.
Wieso ist das aus wissenschaftlicher Sicht wichtig?Kometen sind aus demselben Material entstanden wie das Sonnensystem. Also unsere Sonne, unsere Planeten, die Monde oder auch die Asteroiden. Kometen haben aber die meiste Zeit bei sehr tiefen Temperaturen weit weg von der Sonne verbracht, sozusagen in der Tiefkühltruhe unseres Sonnensystems. Dadurch haben sie ihr Material über viereinhalb Milliarden Jahre konserviert. Sie sind deshalb noch sehr ursprünglich, und das macht sie aus wissenschaftlicher Sicht so interessant. Auf der Erde hingegen haben Schwerkraft, aber auch Erosion und Temperatur das Ursprungsmaterial längst verändert. Auch haben Kometen durch Einschläge Material auf die Erde gebracht, zwar kein Leben, möglicherweise aber wichtige Bausteine dafür. Es stellt sich auch die Frage, ob das Wasser auf der Erde oder Teile unserer Atmosphäre von Kometen stammen. Um unseren eigenen Ursprung zu verstehen, müssen wir also auch in den Weiten des Sonnensystems suchen.
Welcher Nutzen könnte für die Gesellschaft resultieren?Es handelt sich hier um Grundlagenforschung mit dem Ziel des Erkenntnisgewinns. Die Kommerzialisierung steht dabei weniger im Vordergrund als gesellschaftlich relevante Fragen, wie zum Beispiel: «Woraus ist die Erde und letztlich auch wir entstanden?». Immer wieder finden aber auch technische Entwicklungen der Raumfahrt Eingang bei uns im Alltag. Und das, obwohl es ursprünglich gar nicht so geplant war. Beispiele dazu gibt es viele: UV-Filter in Brillen, Handykameras, feuerfeste Anzüge, GPS, Satellitentelefonie. Manchmal führen diese auch zu bedeutenden Fortschritten, wie etwa im Falle der Solarpanele. Zusätzlich bilden wir auch Fachkräfte wie Polymechaniker, Physikerinnen und Physiklaboranten aus. Viele von ihnen werden später in anderen Bereichen der Industrie und Wirtschaft arbeiten.
Was fasziniert Sie persönlich an diesem Forschungsprojekt?Ein Blick in den Himmel fasziniert die meisten Menschen. Bei mir ist es nicht anders. Mir gefällt, wie abwechslungsreich und interdisziplinär Kometenforschung ist. Und dass Kometen wichtige Informationen über die Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems enthalten, macht sie besonders spannend. Es zeigt, dass Kometen auch dann nichts von ihrer Anziehungskraft verlieren, wenn man sie erforscht.
Welches ist die grösste Herausforderung bei Ihrem Forschungsprojekt?Auch für unser internationales Konsortium ist es eine grosse Herausforderung, innerhalb der nächsten zwei Jahre zwei hochkomplexe Instrumente zu bauen. Diese müssen immer an die jeweilige Mission angepasst sein. Bei Comet Interceptor ist insbesondere die Geschwindigkeit des Vorbeiflugs imposant – bis zu 70 Kilometer pro Sekunde, also Bern-Zürich in eineinhalb Sekunden oder mehr als das Siebzigfache der Geschwindigkeit einer Gewehrkugel. Das Problem: Bei diesen Geschwindigkeiten wird jedes Staubkorn zum Geschoss. Raumsonde und Instrumente müssen dies aushalten können und entsprechend geschützt sein.
Wie ist das Forschungsprojekt finanziert?Massenspektrometer und Kamera für Comet Interceptor werden durch die ESA finanziert. Das heisst, unsere Beteiligung stammt aus dem Schweizer Beitrag an die ESA, deren Gründungsmitglied die Schweiz ist. Etwas mehr als die Hälfte davon geht in Form von Aufträgen an die Schweizer Industrie. Beteiligungen unseres internationalen Konsortiums werden entsprechend von deren Ländern finanziert. Bei CoCa und MANiaC sind dies Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Österreich, Polen und Ungarn. Dazu können wir auf Ressourcen und Infrastruktur der Uni Bern zurückgreifen, beispielsweise auf die über viele Jahre aufgebauten Eich- und Testanlagen. Last but not least wird die wissenschaftliche Begleitung derzeit vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt.
Dieser Artikel erscheint auch im Anzeiger Region Bern.
Zur Person

PD Dr. Martin Rubin
PD Dr. Martin Rubin ist Hauptverantwortlicher des Massenspektrometers MANiaC auf Comet Interceptor. Er hat an der Uni Bern Physik studiert und 2006 doktoriert. Danach ging er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die University of Michigan in den USA, bevor er 2012 zurückkehrte und 2015 habilitierte. Martin Rubin leitet die Kometengruppe am Physikalischen Institut und untersucht unter anderem auch die Daten von ROSINA, dem Massenspektrometer, das an Bord der ESA Rosetta-Mission den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko besuchte. Ihn interessiert dabei vor allem, aus was die Kometen bestehen und wie sie mit der Sonne wechselwirken.
Zur Weltraummission
Die Comet Interceptor Weltraummission
Comet Interceptor ist eine neue Art von Mission mit einer Raumsonde, die ihre Reise in den Weltraum antreten wird, bevor überhaupt klar sein wird, welcher Komet konkret untersucht werden soll. In der Folge wird dann ein passendes Ziel ausgesucht, am besten ein Komet, der zum ersten Mal in die Nähe der Sonne kommt.
Comet Interceptor soll zusammen mit der ESA-Raumsonde ARIEL im Jahr 2029 gestartet und zum Lagrange-Punkt L2 auf der von der Sonne abgewandten Seite der Erde gebracht werden, von wo aus sie dann zum Abfangpunkt startet. Es handelt sich um eine mehrteilige Sonde, die aus einer primären Plattform, die auch als Kommunikationszentrum dient, und Sub-Sonden besteht, die gleichzeitige Beobachtungen an mehreren Punkten rund um das Ziel ermöglichen. Die Raumsonden werden erst kurz vor dem Ziel voneinander getrennt. Die Reise- und Wartephase der Mission wird Monate bis Jahre dauern.