Palliativmedizin
«Für ein gutes Lebensende braucht es ein ganzes Dorf»
Das Lebensende mitzutragen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gesellschaft und nicht nur ein Thema für das Gesundheitswesen. Dazu forscht Steffen Eychmüller mit der Forschungsgruppe des Universitären Zentrums für Palliative Care.

Steffen Eychmüller: Nach vielen Jahren in der Akutmedizin und Psychosomatik war ich auf der Suche nach einem Bereich, in dem die Menschlichkeit in der heutigen Medizin im Mittelpunkt steht. Die Palliativmedizin erfordert eine grosse Neugier für die individuelle Lebenswelt – also die subjektive Realität jedes Einzelnen.
Weshalb braucht es Forschung zu diesem Thema?Bei einer schweren Erkrankung geht es darum, nicht nur die medizinische Diagnose zu ergründen, sondern auch herauszufinden, was die Betroffenen in ihrem Leben gerade subjektiv beschäftigt, welche Ängste vorhanden sind. Die Themen Kommunikation und aktives Mitgefühl sind dabei zentral, um dieser subjektiven Wirklichkeit näher zu kommen. Forschung im Bereich Palliative Care steht deshalb immer im Spannungsfeld zwischen Methoden, die in der Medizin als evidenz-vermehrend anerkannt sind, und dem Vorgehen der psychosozialen Forschung. Es geht ausserdem darum, die Gesellschaft für die Bedeutung der Forschung in der Palliativversorgung zu sensibilisieren – es geht ja letztendlich auch um unsere eigene Zukunft.
«Die Themen Kommunikation und aktives Mitgefühl sind in der Palliative Care zentral.»
Steffen Eychmüller
Gibt es spezifische Themen, die es dringend zu erforschen gilt?Zentral ist aus meiner Sicht, die Erforschung heilsamer Interaktionen im psychosozialen Bereich gleich stark zu gewichten wie den heute weit dominanteren Fokus auf genetische oder biologische Interaktionen. Wie beeinflussen kulturelle, soziale, finanzielle und psychologische Systeme das Leben der Menschen – da wissen wir schon viel. Weniger gut kennen wir die Antworten auf diese Fragen im Kontext des Lebensendes.
Was sind die Herausforderungen, wenn man Menschen, respektive deren Lebensende erforschen will?Eine Herausforderung besteht darin, dass wir persönliche Erfahrungen, Meinungen und Perspektiven von Menschen analysieren, und nicht Zahlen, Blutwerte oder «Big Data». Dafür stellen wir den Betroffenen und ihren Angehörigen offene Fragen, vorformulierte Antwortmöglichkeiten greifen hier zu kurz. Diese Ausrichtung ist eine grosse Herausforderung, da wir aktuell für die Eingabe von Forschungsprojekten bei Förderinstitutionen eigentlich bereits am Anfang wissen müssen, was am Schluss herauskommt. Wir betreiben also überwiegend qualitative Forschung. Damit wir Aussagen generieren können, tun wir dies auch im internationalen Kontext, beispielsweise im Rahmen von EU-Projekten.
Der Einbezug von Patienten und Patientinnen sowie ihren Angehörigen ist zentral in der Palliative Care. Wie berücksichtigen Sie deren Perspektiven und Bedürfnisse in Ihrer Forschung?Das sogenannte «Patient and Public Involvement» (PPI), also die sehr aktive Einbindung der Perspektive der Betroffenen, findet auf mehreren Ebenen statt: von der Konzeption eines Projekts, über Inhalte bis hin zur Verständlichkeit von Fragebögen. Die Menschen, denen wir uns nähern, sind schwerkrank oder als Angehörige sehr gestresst, da gilt es mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorzugehen. Wir lernen dabei viel: Was sind die realen Probleme und Herausforderungen der Menschen in dieser Lebensphase? Die Sorge bezüglich der Überlastung der Angehörigen oder auch finanzielle Ängste – «Wer bezahlt das Pflegeheim?» – sind mindestens so dominant wie die Frage, wie die eigenen Organe auf bestimmte Therapien reagieren.
«Es gibt kaum Geld für Probleme in der Alltagsbewältigung.»
Steffen Eychmüller
Wie könnte man diese zentralen Punkte in der Versorgung schwerkranker Menschen stärker einbringen?Indem diese einen Wert bekommen. Wir haben heute ein Vergütungssystem, das auf Diagnosen basiert. Das heisst, es werden primär klassifizierbare, medizinische Diagnosen vergütet. Kaum Geld gibt es für Probleme in der Alltagsbewältigung: Viele Menschen benötigen beispielsweise Support wegen ausgeprägter Müdigkeit oder Schwäche. Wenn wir Menschen wegen eines Tumors mit Hirnmetastasen im Spital behandeln, gibt es klare Tarife. Wenn wir schreiben würden: «Patient ist enorm müde, liegt im Bett, ist extrem belastet und traurig», bekämen wir nahezu keine Vergütung.
Kann die Forschung dazu beitragen, dies zu ändern?Ja. Durch einen starken Fokus auf das Verstehen der Prioritäten der Menschen am Lebensende und eine aufrichtige Kommunikation über realistische Ziele vermeiden wir enorm teure therapeutische Massnahmen in den letzten Lebenswochen, die keinen Benefit an Lebensqualität bringen. Die Qualität dieser Kommunikation vermeidet also unnötige Behandlungen. Solche Interaktionen, die zum Teil viel Zeit in Anspruch nehmen und auch sehr anspruchsvoll sind, sollten deshalb einen gleichen Wert haben wie beispielsweise ein Herzkatheter. Es kann nicht sein, dass nur – oft sehr teure – biotechnologische Massnahmen kostendeckend finanziert werden. Wenn der gemeinsame Weg am Lebensende, die Gespräche, das Verständnis für psychosoziale Themen und sogar finanzielle Fragen besondere Anerkennung in unserem Vergütungssystem finden, werden diese wichtigen Aspekte der Betreuung in Zukunft einen echten Wert haben, und dann auch im klinischen Alltag stattfinden. Deshalb forschen wir auch im Kostenbereich der Betreuung von Menschen am Lebensende, über Anreize und wofür aktuell in den letzten Lebenswochen Geld ausgegeben wird.
Was ist die überraschendste Erkenntnis Ihrer bisherigen Forschung?Es gibt viele erstaunliche Dinge, aber was mich immer wieder überrascht, ist, dass am Ende auch bei sehr komplexen Forschungsprojekten der gesunde Menschenverstand als Ergebnis im Mittelpunkt steht. Sehr häufig geht es um die Qualität der Interaktion: Wie gehen wir miteinander um, wie werden wir wertgeschätzt, wie können wir selbst mit Verletzlichkeit umgehen oder wie gehen wir mit verletzlichen Menschen um? Diese Erkenntnisse mögen banal klingen, sind aber für unser Zusammenleben und den Umgang mit schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen essenziell. Der «soziale Tod» findet heute in vielen Fällen bereits viel früher statt in unserer arbeitsteiligen Welt mit vielen Einpersonen-Haushalten und Kleinfamilien. Diese Ergebnisse sind im Einklang mit auch enorm aufwendigen Studien, wie beispielsweise die «Harvard second generation study», wo sich über eine Spanne von 80 Jahren die Qualität der Beziehungen als wichtigster Faktor fürs Gesundbleiben herausgestellt hat. Wichtiger als Blutfette und Körpergewicht.
«Am Ende steht auch bei sehr komplexen Forschungsprojekten der gesunde Menschenverstand als Ergebnis im Mittelpunkt.»
Steffen Eychmüller
Wie hat sich der Umgang mit Patienten und Patientinnen am Lebensende in der Praxis durch Ihre Forschung verändert?Wir sind sicherlich viel radikaler patientenzentriert geworden im Umgang, noch viel mehr auf Augenhöhe und sehr partizipativ. Dazu kommt auch der grosse Fokus auf die Angehörigen, die ja nach dieser schweren Zeit möglichst gut weiterleben sollen. Diese Aspekte berücksichtigt die Akutmedizin meist wenig. Die Bedeutung einer qualitativ hochstehenden Kommunikation hilft in Zukunft hoffentlich, der Kommunikation als medizinischer Intervention einen grösseren Stellenwert – und auch finanziellen Wert – zu verleihen. Ausserdem hat die Forschung gezeigt, dass die Unterstützung von Menschen am Lebensende ein breites Thema ist, das nicht allein von der Medizin und dem Gesundheitswesen bewältigt werden kann. Es betrifft auch Biografien und Werte – Fragen, mit denen wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen und bei denen wir Verantwortung übernehmen müssen. Nicht nur um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf, wie das bekannte afrikanische Sprichwort sagt – auch für ein gutes Lebensende braucht es ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt.
Ist dies der Bezug zu Public Health?Ja, genau. Public Health in der Palliativmedizin bedeutet, dass wir uns nicht nur um den einzelnen Patienten kümmern, sondern auch überlegen, wie wir die Betreuung für alle Menschen in ähnlichen Situationen verbessern können – auf systemischer Ebene. Dies reicht von gesetzlichen Rahmenbedingungen – beispielsweise die Möglichkeit, die Care-Arbeit zuhause wahrzunehmen, ohne den angestammten Beruf zu gefährden – über Bildungsanstrengungen bis zur Bildung von Nachbarschaftsnetzwerken.
«Nicht nur um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf, wie das bekannte afrikanische Sprichwort sagt – auch für ein gutes Lebensende braucht es ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt»
Steffen Eychmüller
Was bräuchte es, um die Attraktivität der Palliative Care Forschung in Bezug auf Public Health zu steigern?Wir sollten anerkennen, dass es für uns alle brennende gesellschaftliche Fragen gibt, zum Beispiel: Wer soll in Zukunft die vielen schwerkranken Menschen betreuen und mit welcher Kompetenz, wenn wir kaum mehr Fachpersonen haben? Wir brauchen hier nicht nur Antworten, sondern auch politische Entscheidungen, die diese Themen genauso ernst nehmen wie beispielsweise Covid.
Und weiter?Wir müssen definieren, welche Kompetenzen wir in Zukunft im Kontext des Lebensendes benötigen. Und zwar nicht nur gesundheitliche Kompetenz, sondern auch Informations- und Kommunikationskompetenz. Wir müssen die Themen Sterben und Lebensende der Bevölkerung näherbringen, ohne Angst zu erzeugen – das erfordert pädagogische, edukative Fähigkeiten. Und auch die Fachpersonen sollten ein gutes Rüstzeug mitbringen, damit sie frühzeitig die Option Lebensende aktiv ansprechen, um den Patientinnen und Patienten einen selbstbestimmten Weg bei der gesundheitlichen Vorausplanung zu ermöglichen. Schliesslich sollten wir dem ganzen Thema einen positiveren Aspekt abgewinnen: Forschung in diesem Bereich kann einen sinnvollen Beitrag zu dieser sehr relevanten Lebensfrage leisten und beitragen, die Angst vor dem eigenen Lebensende zu reduzieren. Denn immer noch sind wir alle sterblich.
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter. ist ausserordentlicher Professor für Palliativmedizin an der Universität Bern und Chefarzt an der Universitätsklinik für Radioonkologie am lnselspital. Zudem ist er Leiter des Universitären Zentrums für Palliative Care und Mitautor des Sachbuches «Das Lebensende und ich». Eychmüller ist Headmaster der PHPCI Konferenz 2024 (siehe Infobox). Am 22. bis 25. Oktober 2024 findet in Bern die 8. Public Health Palliative Care International (PHPCI) Konferenz unter dem Motto «Brücken bauen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft» statt. Vom 19. bis 27. Oktober 2024 findet ein grosses Stadtfestival unter dem Motto «endlich.menschlich.» statt. Es soll die Diskussion darüber anregen, was ein menschenwürdiges Lebensende bedeutet, und wie wir als Gesellschaft dazu beitragen können, den Umgang mit Fragen rund um Sterben, Tod und Trauer zu enttabuisieren. Mehr Informationen zum Stadtfestival: https://www.endlich-menschlich.ch/uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
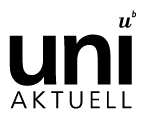
Zur Person

Steffen Eychmüller
Zur Konferenz
Internationale Public Health Palliative Care Konferenz
Zum Stadtfestival
Stadtfestival zum Thema Lebensende
