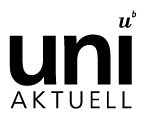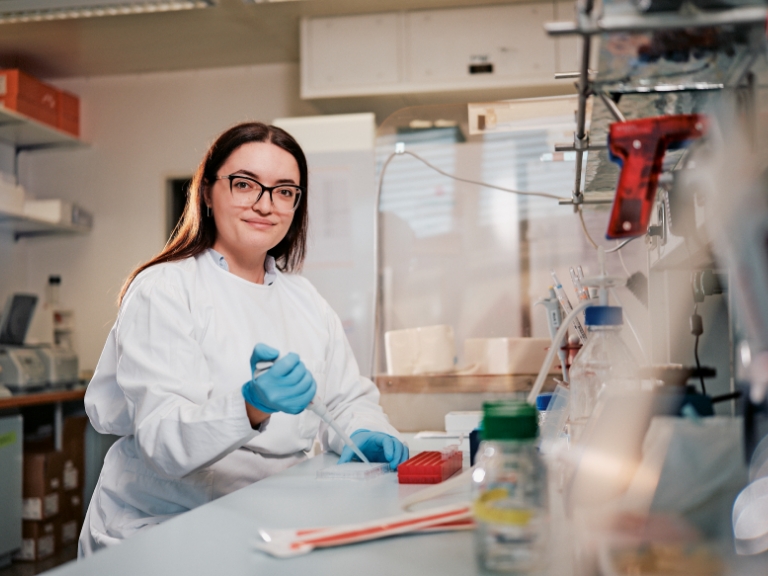Im Fokus
«Ich habe meine Alma Mater als sehr prägend erlebt»
Drei verschiedene Generationen, drei sehr verschiedene Studierendenleben. Wir haben uns mit Alumni der Uni Bern im Länggassquartier zu einem ungezwungenen Austausch getroffen und sind letztlich viel länger sitzen geblieben als geplant. So viele Themen, so viele Erinnerungen!

Rolf Schneider: Ich erinnere mich vor allem an den guten Zusammenhalt unter den Studierenden – die gesamte Studentenschaft der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät hat gemeinsame Ausflüge gemacht, alle Studierenden plus die Professoren. Und auch eine prägende Erinnerung: In den Vorlesungen mussten die Fenster immer geschlossen sein, weil von draussen konstant Baulärm kam. 1957 wurde die Grosse Schanze abgebaggert, da war eine riesige Baustelle gleich hinter dem Hauptgebäude der Uni.
Dominique Nagpal: Ich war bestimmt nicht eine typische Studentin für meine Generation. Ich war auch schon fast 28 Jahre alt, als ich anfing, ich hatte schon ein Berufsleben, habe während des Studiums Leute geführt, das musste ich alles unter einen Hut bringen. Für mich war das Studium auf jeden Fall eher Weg als Ziel, ich wollte nicht einfach möglichst rasch und bequem einen Abschluss machen. Ich erinnere mich noch daran, wie ich es wahnsinnig genoss in einer guten Vorlesung, wie ich von diesem Wissen profitieren wollte, während andere vielleicht lieber im Freibad Marzili gewesen wären.
Afreed Ashraf: Man wird ja direkt ein wenig nostalgisch, wenn man euch so zuhört. Bei mir fängt es natürlich mit dem Numerus clausus an und dem grossen Stein, der einem vom Herzen fällt: Nun bin ich drin!
Dominique Nagpal: Wolltest du immer schon Arzt werden?
Afreed Ashraf: Ja. Gerade kürzlich hat mir eine alte Freundin erzählt: «Afreed, du hast schon in der ersten Klasse gesagt, dass du Arzt werden willst!» Das Studium habe ich dann als wahnsinnig abwechslungsreich erlebt. Was man zum Beispiel nie vergisst: das erste Mal im Anatomiesaal, und da liegt ein echtes Bein auf dem Tisch, mit Tüchern abgedeckt. Und der Dozent begrüsst die vielleicht 50 bis 60 Studierenden: Ihr werdet heute etwas erleben, das den wenigsten Studierenden vergönnt ist – seht es als Privileg. Und alle schauen sich an und fragen sich, was da auf sie zukommt. Das Hauptgebäude dagegen ist für mich kaum ein Referenzpunkt, da hatten wir leider gar keine Vorlesungen.
Rolf Schneider: Wie viele wart ihr denn jeweils in den Vorlesungen?
Afreed Ashraf: 250 bis 300 im Hörsaal, inzwischen sind es, glaube ich, schon gegen 400. Das änderte sich dann allerdings stark in den Praktika, die macht man in Fünfergruppen.
Dominique Nagpal: Ah, so ungefähr wie in der TV-Serie «Grey’s Anatomy»?
Afreed Ashraf: Ziemlich genau so muss man sich das vorstellen, ja.
Zur Person

Afreed Ashraf
(*1997) hat seinen Bachelor und Master in Humanmedizin an der Universität Bern gemacht (Abschluss 2023). Derzeit ist er Assistenzarzt im Notfallzentrum des Lindenhofspitals. Seit August 2022 ist er Host und Moderator der Sendung «Puls Check» von SRF, daneben hat er zusammen mit einem Studienfreund den Podcast/YouTube-Kanal «Swissmedtalk» aufgebaut, der Interviews mit Ärztinnen und Ärzten bringt.
Dominique Nagpal: Ja, man kannte sich, vor allem im Master, bei uns war das einigermassen überschaubar, das waren vielleicht 40 Leute im ganzen Jahrgang.
Rolf Schneider: Bei uns hat man nur Einzelne gut gekannt. In jeder Vorlesung gab es wieder eine andere Zusammensetzung. Aufgefallen sind vor allem die Frauen, das waren ganz seltene Exemplare.
Dominique Nagpal: Ah, bei uns gab es einen Frauenüberhang. Aber das war in der Philosophisch-Historischen Fakultät wohl schon früher so?
Afreed Ashraf: Bei uns hat sich das stark aufgeteilt, weil ein Grossteil des Unterrichts in Zehnergruppen passiert, da kannte man sich natürlich gut, das ist fast wie ein Klassenverband. Da habe ich dann auch ganz verschiedene Dialekte gelernt, es kamen Studierende aus der ganzen Schweiz nach Bern.
Und das berühmte «Studentenleben»? Wenig studieren, viel Party, oder wie war das genau?Dominique Nagpal: Also, ich hatte wie gesagt ein eher untypisches «Studentenleben», nämlich im Grunde gar keins. Ich habe während des Studiums zunächst 80 Prozent, dann 50 Prozent gearbeitet. An Partys hat man mich kaum angetroffen.
Rolf Schneider Viel Sozialleben passierte beim Unisport. Da habe ich die ehemaligen Maturfreunde auch wieder getroffen, sonst hätte man sich wohl aus den Augen verloren, weil alle etwas anderes studierten. Und nach dem Sport ging man dann gern auch noch auf ein Bier.
Afreed Ashraf: Ich war auch viel im Unisport, das war auf jeden Fall ein wichtiger Sozialfaktor. Wobei man da nicht selten auch noch weiterstudiert hat, man konnte die Vorlesungen auch als Podcast hören.
Dominique Nagpal: Wie war das bei dir, Rolf, mit dem Beginn am Morgen? War das noch konsequent erst um 10 Uhr?
Rolf Schneider Ja, und um 17 Uhr waren die Vorlesungen zu Ende, dann hatte man Feierabend.
Dominique Nagpal: Bei uns hat das eben gerade geändert, Unterrichtsbeginn war nun oft schon um 8 Uhr morgens.
Afreed Ashraf Ja, das war bei uns auch normal. Erst um 10 Uhr, das wäre ja auch nicht schlecht gewesen.
Wie war es mit der Anwesenheitspflicht?Rolf Schneider: Zu Beginn des Semesters hat man für jede Lehrveranstaltung ein Testat abgeholt (holt das alte Testatheft aus der Mappe). Hier sind auch noch die Kosten für jede Lehrveranstaltung eingetragen. Diese musste man zu Beginn des Semesters begleichen, damit man die entsprechenden Vorlesungen besuchen durfte.
Afreed Ashraf: Zu den Studiengebühren noch dazu?
Rolf Schneider: Ja, das kam noch obendrauf, jede Lehrveranstaltung hat noch gekostet. Und am Ende des Semesters hat man sich vom Professor den Besuch der Vorlesungen wiederum bestätigen lassen, per Unterschrift. Man hat sich natürlich von Studenten erzählt, die am Anfang und zum Schluss des Semesters pflichtschuldig anwesend waren und dazwischen nicht oft gesehen wurden, aber das war wohl einfach ein Gerücht.
Dominique Nagpal: Wir hatten tatsächlich auch noch ein Testatheft, der Besuch einer Vorlesung wurde bei uns auch noch analog per Unterschrift bescheinigt. Ich weiss noch um den Stress, bei mitunter 100 Studierenden in einer Vorlesung nicht an die Testatunterschrift zu kommen, dann hätte man das Modul noch einmal machen müssen. Das Schlangestehen war nicht besonders angenehm, vor allem bei meinem sonstigen Pensum.
Afreed Ashraf: Wir hatten etwa 50 Prozent Anwesenheitspflicht, den Rest machte man im Selbststudium. Dazu kann man wie gesagt auch noch Podcasts hören, wenn man will. Wenn der Tag sonst vollkommen voll ist, dann hört man eben um 22 Uhr abends noch eine Vorlesung, möglichst in zweifacher, im Notfall auch mal in dreifacher Geschwindigkeit.
Rolf Schneider: Stellt euch mal vor, dieser Riesenunterschied, verglichen mit der Zeit, als vorne alles nur auf der Wandtafel notiert wurde und man das im Heft mitschrieb.
Zur Person

Dominique Nagpal
(*1977) wurde als Tochter einer Schweizer Mutter und eines indischen Vaters in Bern geboren. Als Absolventin eines Kunstgymnasiums in Zürich kehrte sie nach Bern zurück und studierte Deutsche und Englische Literaturwissenschaften, den Abschluss machte sie 2010. Nach langjähriger Tätigkeit in den Bereichen Informatik und Wirtschaft folgte eine Ausbildung als Mediatorin. Heute ist sie als Hörerin für Psychologie und Philosophie an ihre Alma Mater zurückgekehrt.
Rolf Schneider: Wir hatten nur Stift und Papier zur Verfügung. Wenn ein Kommilitone fehlte, dann hat man eben ein Blaupausenpapier – wer weiss überhaupt noch was das ist? – daruntergelegt, dann hatte man zwei Mitschriften.
Afreed Ashraf: Bei uns war alles digital, fast alle kamen mit Laptops – ein Dozent nannte sie die leuchtenden Äpfel – in die Vorlesungen.
Dominique Nagpal: Bei uns war das gerade im Umbruch. Mir ist der Kopierer sehr geblieben. Denn es gab da diesen Ordner in der Bibliothek, in dem die Vorlesungsunterlagen abgelegt waren – kopieren musste man die selbst. Das erforderte auch einiges an Organisation – oft war der Ordner eben nicht an seinem Platz, sondern irgendwo im Umlauf. Dann bin ich eben am Abend um 20 Uhr nach der Arbeit noch einmal hin, um die Unterlagen in Ruhe zu kopieren.
Afreed Ashraf Ah, mir kommt gerade in den Sinn: Wir hatten tatsächlich noch einen Dozenten mit Hellraumprojektor, der ist berühmt unter den Studierenden in der Medizin, wie er seine chemischen Formeln auf die Folien gezeichnet hat!
Afreed Ashraf Dominique Nagpal: Ich habe schon «favourism» erlebt, manifesten Machtmissbrauch eher nicht. Es war schon eine sehr elitäre Welt, irgendwann stellte sich mir dann die Frage: Wer wären meine Peers, wenn ich diesen akademischen Weg auch ginge? Das wollte mir nicht so recht gefallen. Ich habe Dozierende erlebt, die wirklich mit ganzem Herzen für uns da waren, die sich ihrer Aufgabe auf wirklich ermutigende, unterstützende Weise gewidmet haben. Und leider auch andere. Rolf Schneider: Nein! Das waren absolute Respektspersonen, das Verhältnis war geprägt von grossem Respekt. Dominique Nagpal: Es kam ein wenig auf die Stufe an. Aber das mit dem Du oder Sie ist im Englischen ja sowieso ein wenig anders. Dominique Nagpal: Ab dem Masterstudium durchaus sehr. Da gab es spürbare Seilschaften: Es ging stark darum, wer auserkoren wird für eine akademische Karriere, Dozierende hatten durchaus ihre Lieblingsstudierenden, die Konkurrenz war spürbar. Afreed Ashraf: Im Medizinstudium steckt das Leistungssystem drin, das ist klar. Das fängt schon mit dem Numerus clausus an. Aber sobald man drin ist, unterstützt man einander, das hat zu einer grossen Solidarität unter den Studierenden geführt. Man hat sich gegenseitig geholfen, man hat Lerndefizite aufgefangen. Denn man wusste: Wir müssen einfach unsere Leistung bringen, dann werden wir auch durchkommen. Rolf Schneider Rolf Schneider: In meinem speziellen Fall konnte ich meine politische Gesinnung eher festigen, ich ging später dann ja auch in die Politik. Wobei: Wir haben schon als Gymnasiasten eifrig im Jugendparlament mitgemacht, ich brachte die Gesinnung schon an die Uni mit. Es ging also eher weniger darum, eine kritische Haltung zu entwickeln. Rolf Schneider: Nein, die waren bei uns kaum präsent. Ich erinnere mich aber noch, dass man bei Professor Marbach mit Vorteil vor der Prüfung die Metallarbeiterzeitung lesen musste, weil er dort publizierte. Dominique Nagpal: Ich habe das schon so erlebt, dass man nah dran war am politischen Tagesgeschehen, ich erinnere mich auch an regelmässige politische Diskussionen auf dem Campus. Es ging viel um soziale Themen, um postkoloniale Zugänge, ungefähr das, was inzwischen in die Identitätspolitik gemündet hat. Wir haben uns insofern schon als kritisch denkende Zeitgenossen gesehen, auch wenn das nicht zwingend zu politischem Aktivismus führen musste. Was sicher auch damit zu tun hatte, dass man so viele Leute aus unterschiedlichen Kontexten trifft. Interessanterweise habe ich das Gymnasium noch eher als homogene elitäre Welt erlebt, als Abbildung des Bildungsbürgertums. (*1936) studierte in Bern und Bordeaux Wirtschaftswissenschaften, er machte seinen Abschluss im Jahr 1962. Von 1992 bis zu seiner Pensionierung im Herbst 2001 leitete er die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) in Bern, wo er auch als Dozent für Volkswirtschaftslehre wirkte. 1982 erfolgte seine Wahl in den Grossen Rat des Kantons Bern, dem er während zweier Legislaturperioden angehörte. Von 1986 bis 1992 präsidierte er die FDP des Kantons Bern. Afreed Ashraf: Die Klimathematik war bereits am Rand ein Thema. Die Medizin ist ja immer in Bewegung, gerade jetzt verändert sich das wieder sehr schnell. Auch an einen Kurs in Umweltchemie erinnere ich mich. Aber wenn ich mit jüngeren Studierenden rede, merke ich, dass Umweltthemen noch viel stärker in den Fokus rücken. Aber auch soziale Fragen wie gendergerechte Medizin wird jetzt gelehrt, das war bei uns noch kaum ein Thema. Dominique Nagpal: Bei uns waren manche Brennpunkte durchaus Teil der Fachdiskussion, es ging ganz zentral darum, wie der Textkanon aufgeweicht und über den klassisch eurozentristischen Kern erweitert werden kann. Das waren vielleicht nicht gleich Forderungen nach einem Systemumbruch, aber es gab durchaus Parallelen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Rolf Schneider: Ich weiss noch, dass bei uns Europa ein grosses Thema war. 1957 wurde ja die EWG gegründet. Afreed Ashraf: Was ist das? Rolf Schneider: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das war der Vorläufer der EU. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit, da gab es schon sehr lebendige Diskussionen zur Frage, wie sich die Schweiz dazu stellen soll, auch unter uns Studierenden. Dominique Nagpal Rolf Schneider: Es ging nicht einfach um abstraktes Wissen, beeindruckend war für mich auf jeden Fall die Persönlichkeit der Professoren, allesamt absolute Koryphäen auf ihrem Gebiet. Diese Kompetenz hat man anerkannt und bewundert. Letztlich war mein Eindruck, dass wir an der Uni Bern perfekt auf unser Berufsleben vorbereitet wurden. Dominique Nagpal: Ja, wir wurden auf jeden Fall bestens alimentiert. Ich habe meine Alma Mater als sehr formativ, sehr prägend erlebt. Wir wurden zu eigenem Denken ermutigt, wir wurden im besten Sinn «empowered». Afreed Ashraf: Man hört immer wieder, dass die Berner super Ärztinnen und Ärzte machten, und das kann ich nur unterschreiben. Ich würde sofort wieder diesen Weg gehen – eben gerade deshalb, weil es an der Uni nicht nur darum ging, Fachwissen anzuhäufen. Aus uns wurden eben tatsächlich Ärzte «gemacht», dazu gehört nicht nur fundiertes Wissen, dazu gehören auch soziale Skills. Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Studieren» Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.«Man unterstützt einander, das hat zu einer grossen Solidarität unter den Studierenden geführt.»
«Die Dozierenden waren absolute Respektspersonen.»
Zur Person

Rolf Schneider
«Wir wurden zu eigenem Denken ermutigt, wir wurden im besten Sinn 'empowered'.»
Magazin uniFOKUS

«Startrampe Studium»
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren