Im Fokus
Afrika – ein Kontinent auf dem Weg zur Selbstbestimmung?
Zwischen kolonialer Vergangenheit und Wirtschaftsmotor der Zukunft: Irgendwo dazwischen liegt Afrika. Eine Standortbestimmung von Chinwe Ifejika Speranza vom Geographischen Institut und Thomas Breu vom Centre for Development and Environment.

Chinwe Ifejika Speranza: In Afrika gibt es diese Offenheit gegenüber anderen, weil es aufgrund der vielen Kulturen gar nicht anders geht. Dieses Prinzip der Gemeinschaftlichkeit, das im südlichen Afrika «Ubuntu» genannt wird, verkörpert diese Lebensphilosophie auf dem ganzen Kontinent. Auch die Kolonialgeschichte enthielt vielerorts verbindende Elemente, obwohl sie unterschiedlich verlief.
Thomas Breu: In vielen afrikanischen Ländern lässt sich eine positive Entwicklung beobachten: Die Zivilgesellschaft wird stärker, und vor allem die jüngere Generation zeigt ein wachsendes Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite gibt es jedoch eine besorgniserregende Tendenz. Im Zuge der geopolitischen Blockbildung werden die noch jungen afrikanischen Demokratien zunehmend von autokratischen Regimen verdrängt.
Kämpft Afrika noch immer mit seiner Geschichte?Ifejika Speranza: Ja. Vieles wird noch heute durch die Kolonialvergangenheit erschwert. Ein Beispiel dafür ist die Verwaltung. Die staatlichen Schulsysteme, Landrechte und so weiter sind durch die Kolonialherrschaft geprägt. Daneben existieren aber weiterhin die traditionellen, vorkolonialen Systeme. Wenn ich Land kaufen möchte, dann geschieht das innerhalb des modernen staatlichen Systems. Je nachdem, wo ich bin, muss ich aber denselben Kauf auch über das traditionelle System abwickeln.
«Vieles wird noch heute durch die Kolonialvergangenheit erschwert.»
Chinwe Ifejika Speranza
Es gibt zwei Grundbücher?Ifejika Speranza: Sozusagen, ja. Das des Staates und das des Dorfes. Diese zwei Systeme existieren oft parallel. Manchmal sind sie komplementär, aber meistens stellen sie ein gegenseitiges Hindernis dar.
Trotz dieser Herausforderungen wird Afrika, insbesondere wegen seiner sehr jungen Bevölkerung, ein grosses Potenzial zugeschrieben. Wie kann Afrika dieses Potenzial ausschöpfen?Ifejika Speranza: Es braucht Infrastruktur. Wenn man keinen Strom hat, kann man auch nicht programmieren oder als Mechaniker arbeiten. In vielen afrikanischen Ländern schränkt das die Möglichkeiten ein. Andererseits sind einige afrikanische Länder sehr weit, was die technologische Innovation angeht – etwa den Zahlungsverkehr über Mobiltelefone. Da hinkt die Schweiz mit Twint hinterher. Doch es fehlen die ausländischen Investitionen. Das liegt nicht zuletzt an den politischen Rahmenbedingungen. Hier braucht es eine Weiterbildung von Politikerinnen und Politikern, um sie zur Verbesserung dieser Bedingungen zu befähigen. Und: Deren Entscheidungen müssen transparent sein. Das würde helfen, das Vertrauen zwischen den verschiedenen Gruppierungen zu erhöhen.
Breu: Es braucht meiner Meinung nach auch Investitionen in die Bildung, nicht zuletzt auf Hochschulebene. Und es braucht Konfliktfreiheit. Dazu trägt auch die Wirtschaftsstruktur bei.
Wie meinen Sie das?Breu: Viele afrikanische Volkswirtschaften sind einseitig geprägt. Häufig sind sie von Exporten in globale Märkte abhängig, etwa bei Landwirtschaftsprodukten oder Bodenschätzen.
Warum ist das ein Problem?Breu: Beispielsweise ist der Rohölexport in Nigeria so hoch, dass dadurch die Entwicklung einer differenzierten Wirtschaft, von der auch andere Sektoren etwas haben, behindert wird. Das kann in der Folge zu Importabhängigkeiten führen. Einseitige Volkswirtschaften verhindern auch den Aufbau eines Mittelstandes, der gerade für die Stabilität in Konfliktfällen extrem wichtig ist. Das hat sich 2008 in Kenia gezeigt, als nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl gewaltsame ethnische Konflikte ausgebrochen sind. Der kenianische Mittelstand hat dazu beigetragen, dass der Konflikt nicht ausser Kontrolle geriet.
Ist die Differenzierung der Wirtschaft aber nicht zumindest regional im Gang? Sie haben die fortgeschrittenen Tech-Innovationen erwähnt. Und Google und Microsoft haben Büros in Nairobi.Ifejika Speranza: Diese machen im Vergleich zu den Rohstoffen aber noch immer einen sehr kleinen Teil aus. Auf absehbare Zeit wird das wohl auch so bleiben.
Um den Zugang zu Rohstoffen sowie günstigen Arbeitskräften und Produktionsbedingungen sicherzustellen, investiert beispielsweise China viel – etwa in Form der Eisenbahnstrecke zwischen der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba und Dschibuti. Ist das eine neue Form von Kolonialismus, oder sind damit auch Chancen verbunden?Ifejika Speranza: Es sind die afrikanischen Länder, die sagen: «Wir möchten, dass ihr für uns diese Strassen baut, und dafür bekommt ihr im Gegenzug etwas.» Insofern ist das ein Geben und Nehmen. Andererseits frage ich mich, was nun mit diesen Strassen oder dieser Infrastruktur passiert, wie nachhaltig sie sind. Wenn beispielsweise eine Infrastruktur vollumfänglich aus China importiert oder auch von chinesischen Arbeitern vor Ort aufgebaut wird, wird selten geschaut, ob das jemand im Land reparieren kann, wenn etwas kaputtgeht.
Magazin uniFOKUS
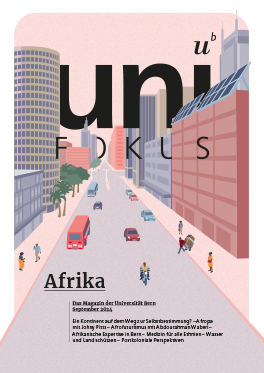
«Afrika»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Afrika»
uniFOKUS als Magazin abonnierenBreu: China ist übrigens nicht der grösste Investor in Afrika, wie man immer meint, sondern es sind die Vereinigten Arabischen Emirate – zumindest was die direkten Kapitalinvestitionen betrifft. Grundsätzlich finde ich es bedauerlich, dass es sich bei diesen Investitionen mehrheitlich um grosse Infrastrukturen handelt – also zum Beispiel eine sechsspurige Autobahn von Mombasa nach Nairobi oder eben die Eisenbahnstrecken. Was aber zu wenig passiert, sind Investitionen, die der gesellschaftlichen Entwicklung dienen.
Was meinen Sie damit?Breu: Zum Beispiel den Aufbau von Märkten und Wertschöpfungsketten, die der Bevölkerung dabei helfen, Produkte zu entwickeln und zu gerechten Preisen in der Region zu verkaufen. Oder digitale Applikationen, welche die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes nach unterschiedlich qualifizierten Arbeitskräften effizient abdecken würden. Für die Stärkung der Zivilgesellschaft, für die Ausbildung einer differenzierteren Wirtschaft bräuchte es solche Investitionsformen.
Warum werden sie nicht getätigt?Breu: Mit dem Washington-Konsens, also mit einer Reihe von Restrukturierungsprogrammen Ende der 1980er-Jahre, hat die Weltgemeinschaft alle Investitionen in solche sozialen Infrastrukturen praktisch lahmgelegt. Da hat der Westen aus meiner Sicht massive Fehler gemacht. Er hat diesen Staaten ein neoliberales System aufgezwungen. Man ging davon aus, dass der Trickle-Down-Effekt, also das Durchsickern des Einkommenswachstums von oben nach unten, stattfinden würde und am Ende alle davon profitieren würden. Doch der Effekt blieb aus, und in das Vakuum sozialer Investitionen traten rein profit- oder geopolitisch orientierte Akteure.
Sie sprechen damit auch die Entwicklungszusammenarbeit an. Diese ist aktuell in der Schweiz ein Streitthema. Der Bundesrat hat die Entwicklungsgelder zuungunsten des globalen Südens, insbesondere Subsahara-Afrikas, umverteilt.Breu: Ich finde diese Entwicklung äusserst problematisch. Auch dass die Schweiz Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe zusammenführt. Wir sind eine Welt, und was im globalen Süden passiert, hat auch hier einen Einfluss. Globale Herausforderungen, sei es das Klima, sei es die Biodiversität, sei es Migration oder seien es Pandemien, können wir nur zusammen lösen, über die Staatsgrenzen hinaus.
«Es gibt zu wenige Investitionen, die der gesellschaftlichen Entwicklung dienen.»
Thomas Breu
Welche Entwicklungszusammenarbeit sollte die Schweiz betreiben?Ifejika Speranza: Die Hauptfrage sollte sein: Was kann man dazu beitragen, um die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern? Etwa indem Firmen gerechte Löhne zahlen und ihre Verantwortung vor Ort wahrnehmen. Wenn man die Lebensbedingungen verbessert, können viele Leute auch vor Ort bleiben.
Breu: Zentral sind meiner Meinung nach der Aufbau der Wissensgesellschaft und die Stärkung der Zivilgesellschaft, damit die Menschen die Dinge selbst in die Hand nehmen können. Die Nachfrage für Unterstützung in diesen Bereichen ist sehr gross. Der Schweizer Nationalfonds investiert im Moment aber nur rund ein Prozent in die Forschungszusammenarbeit mit dem globalen Süden. Dazu kommt, dass der Entwicklungspolitik die Aussenhandelspolitik gegenübersteht, die auf möglichst gute Bedingungen für Schweizer Unternehmen ausgerichtet ist und kaum verantwortliches Wirtschaften von Konzernen einfordert. Die beiden Politikbereiche stossen also nicht in dieselbe Richtung. In einer kohärenten Ausrichtung der verschiedenen Politikbereiche sehe ich ein riesiges Potenzial.
Was kann die Universität Bern tun?Breu: Wir sollten die Forschungszusammenarbeit mit Afrika, wie es ja in der Initiative Afrique vorgesehen ist, deutlich stärker fördern. Das Hauptproblem in Afrika ist, dass es verhältnismässig wenig ausgebildete Lektoren, Dozentinnen und Professoren gibt. Bildungshunger und Bildungsbedarf dagegen sind sehr gross. Die Universitäten werden von Studierenden geradezu überrannt.
Zur Person

Chinwe Ifejika Speranza
ist Professorin für Geografie und nachhaltige Entwicklung. Sie leitet die Forschungsunit «Landsysteme und Nachhaltige Ressourcennutzung» am Geographischen Institut (GIUB) der Universität Bern. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der nachhaltigen Landnutzung und deren Wechselwirkungen mit ökologischen Prozessen in Afrika, der Schweiz und global.
Ifejika Speranza: Die Forschung sollte in afrikanischen Ländern einen höheren Stellenwert erhalten. Gerade für die Qualität der Ausbildung – aber auch für die Entwicklung von Innovationen – ist das entscheidend. Einige afrikanische Länder haben dies erkannt und begonnen, in die Forschung zu investieren.
Während wir darüber sprechen, wie wir Afrika unterstützen können, sein Potenzial zu entfalten, bedrohen wir den Kontinent mit unserem Lebensstil. Afrika ist eine der am stärksten vom Klimawandel betroffenen Regionen der Welt. Wo sehen wir das schon heute?Ifejika Speranza: Zum Beispiel im Osten Kenias, wo die Dürreperioden heftiger werden. Und wenn es dann regnet, kommt es vermehrt zu Überschwemmungen. Ob sich Afrika an den Klimawandel anpassen kann, hängt davon ab, wie resilient die Gesellschaft ist – sozial und wirtschaftlich. An vielen Orten gibt es keine Versicherungen gegen Krankheit oder Ernteausfälle. Die Leute sind grösstenteils auf sich gestellt.
Die Bedrohung ist gross, obwohl Afrika sehr wenig zur Klimakrise beigetragen hat. Wie beurteilen Sie die «Klimaschuld» der Industrienationen?Ifejika Speranza: Das grosse Problem ist, dass das Geld nicht ausreicht. Einerseits weil die Versprechungen höher sind als das, was die Industrieländer bisher bezahlt haben. Andererseits sind die Berechnungsmethoden schwierig. Die monetäre Bewertung der Landwirtschaft in Afrika ist vergleichsweise niedrig. Das bedeutet, dass Verluste gering entschädigt werden. Die Leute leiden aber trotzdem. Deshalb müssen andere Massnahmen oder Wege gefunden werden, um diese Verluste wettzumachen.
Breu: Ich sehe einen weiteren Bereich, über den ich mich mehr sorge: dass die Kompensation des Treibhausgasausstosses aus dem Norden zu einer kolonialen Art von Landnahme führen kann.
Zum Beispiel durch Aufforstungsprojekte?Breu: Ja. Das dafür vorgesehene Land ist eigentlich nie ungenutzt. Wenn nun öffentliche Güter wie Wald plötzlich unter Schutz gestellt werden und der traditionelle Zugang für die ansässigen Leute abgeschnitten oder limitiert wird, kann das die Armut verschärfen. Nebst ein paar wenigen Gewinnern gibt es viele Verlierer.
Zur Person

Thomas Breu
ist Professor für nachhaltige Entwicklung und Direktor des Centre for Development and Environment (CDE) der Universität Bern. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der nachhaltigen Entwicklung in einer globalisierten Welt mit Fokus Ressourcennutzung, insbesondere in Afrika und Südostasien.
Ifejika Speranza: Es ist der Staat, der Versprechungen macht, aber es sind die Dörfer und Gemeinschaften, die das Land hergeben müssen. Deshalb braucht es ein Zusammenrücken von traditionellen und staatlichen Systemen von Landbesitz. Auch damit jeder sehen kann, wer die Entscheidungsmacht hat und wer davon profitiert. Sonst führt das zu Konflikten.
Sprechen wir in 30 Jahren immer noch über das Potenzial, oder hat sich Afrika bis dahin als wichtiger globaler Player etabliert?Breu: Meine hoffnungsvolle Aussage wäre: Ja, Afrika durchlebt eine selbstbestimmte Entwicklung, die der Gesellschaft dient, und wird ein respektierter Partner in der Weltgemeinschaft.
Und die nüchterne?Breu: Wir erreichen unser Wachstum durch Ressourcenverbrauch. Ich glaube nicht, dass die afrikanischen Staaten dieselben Fehler machen sollten, bezweifle aber, dass sie es schaffen, in so kurzer Frist die Armut zu beseitigen, ohne selbst deutlich mehr Ressourcen zu verbrauchen. Dazu kommt, dass wir unsere Art der Zusammenarbeit überdenken müssen. Dafür stehen die Zeichen weltweit leider nicht besonders gut.
Ifejika Speranza: Es wird Gebiete geben, in denen viele Dinge besser funktionieren – die gibt es ja teilweise bereits, etwa in Ghana, wo sich unter anderem dank Investitionen in Bildung und Gesundheit die Lebensbedingungen deutlich verbessert haben. Dann wird es Gebiete geben, die noch Schwierigkeiten haben werden, aber es werden weniger sein als jetzt. Ich sehe das eher positiv.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
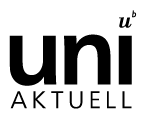
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.


