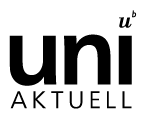Frauengesundheit
«Es fehlt sehr viel Grundwissen zu weiblichen Körpern»
Frauen sind in allen Bereichen des Schweizer Gesundheitssystems benachteiligt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung IZFG der Uni Bern. Ein Gespräch mit zwei der Co-Autorinnen, Christine Bigler und Tina Büchler.

Die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind ein «kritischer Faktor» für die Volksgesundheit. Dies hat die UNO bereits 1995, also vor fast 30 Jahren, offiziell festgehalten. Es ist kein Geheimnis: Diese Ungleichheiten gereichen überwiegend zum Nachteil der Frauen. Das vielzitierte Beispiel Herzinfarkt – der bei Frauen häufiger tödlich verläuft, weil er sich anders als bei Männern äussert – liess dies mittlerweile im öffentlichen Bewusstsein ankommen. In welchem Ausmass und in welchen Bereichen die Benachteiligung noch heute auf die Schweiz zutrifft, hat das IZFG im Auftrag des Bundesamts für Gesundheit BAG erforscht. Die Autorinnen haben Hauptproblembereiche identifiziert und schlagen Massnahmen für ein geschlechtergerechtes Gesundheitssystem vor.
Christine Bigler: Nein, im Grundsatz nicht. Aber uns hat überrascht, in welchem Ausmass und in welcher Tiefe Frauen benachteiligt sind. Erstaunlich ist auch, wie gross der Mangel an gendersensitiver Forschung im Gesundheitsbereich ist, und wie sehr sich dies auf die medizinische Behandlung auswirkt.
Tina Büchler: Uns war nicht bewusst, wie weit die Benachteiligungen nicht nur in die Forschung und in die Behandlung reichen, sondern auch in die Diagnostik, Rehabilitation und Prävention. Die Beispiele dafür sind so zahlreich und vielfältig, dass es nicht bei Beispielen bleibt, sondern eine Systematik sichtbar wird.
Woran lässt sich dies für die Forschung festmachen?
Bigler: In der Schweiz gibt es sehr wenige Forschende auf dem Gebiet einer gendersensitiven Medizin, erst recht auf Stufe Professur. Das Feld ist so übersichtlich, dass wir für unsere Studie die meisten dieser Fachpersonen konsultieren konnten.
Büchler: Dazu kommt, dass geschlechtersensible Forschung und Angebote in der Schweiz stark personengebunden sind. Als etwa die Basler Psychiatrie-Professorin Anita Riecher-Rössler emeritiert wurde, gingen die Sprechstunden zur Menopause und zu Psychopharmaka in der Schwangerschaft verloren, obwohl sie stark nachgefragt waren. Sprechstunden zu Psychopharmaka beispielsweise wären aber sehr wichtig, weil Frauen mit diesen Medikamenten häufig Probleme haben. Dieses Manko steht im Gegensatz zu internationalen Modellen: In Grossbritannien zum Beispiel sind gewisse gendersensible Angebote institutionalisiert und im Leistungsauftrag eines Spitals enthalten.
«Es fehlen verlässliche gendersensible Daten für das gesamte Schweizer Gesundheitssystem»
Christine Bigler
Wie sieht es im Vergleich von Grundlagenforschung zu klinischer Forschung aus?
Büchler: Es hat uns ziemlich erschreckt, dass sich in der biomedizinischen Grundlagenforschung und in der akademischen medizinischen Forschung noch immer teilweise eine massive Überrepräsentation von männlichen Zellen, Tieren und Menschen feststellen lässt. Das bedeutet, dass sehr viel Grundwissen zu weiblichen Körpern schlicht fehlt.
In den klinischen Studien, etwa für Medikamentenzulassungen, sind Frauen zwar besser vertreten, aber immer noch unterrepräsentiert. Aber auch unter den Forschenden sind Frauen in vielen Fachbereichen unterrepräsentiert. Dagegen ist nachgewiesen, dass mehr Frauengesundheitsthemen beforscht werden, je mehr Forscherinnen es auf einem Gebiet gibt.
Bigler: Zusammen mit der fehlenden Institutionalisierung ergeben sich so sehr grosse Forschungslücken. Es fehlen verlässliche gendersensible Daten für das gesamte Schweizer Gesundheitssystem.
Mit welchen Konsequenzen?
Büchler: Diese Lücke zieht handfeste Nachteile für Frauen nach sich. Zum Beispiel führt es zu unangemessenen Dosierungen bei Chemotherapien oder in der Behandlung mit Psychopharmaka, mit der Folge, dass Frauen mehr Nebenwirkungen erleiden und schlechtere Prognosen haben. Gleichzeitig ist vieles noch nicht systematisch untersucht worden. Obwohl aus der Praxis viele geschlechtsspezifische Phänomene hinlänglich bekannt sind, fliessen zu wenig Forschungsgelder in deren Untersuchung.
Wie konnten Sie trotz der Forschungslücken zu dem Schluss kommen, dass Frauen in allen Bereichen des Schweizer Gesundheitswesens benachteiligt sind?
Bigler: Wir haben unsere Studie sehr breit abgestützt. Zunächst haben wir auf Grundlage einer eingehenden Analyse der wissenschaftlichen Literatur, der Zusammenarbeit mit internen Expertinnen aus dem Bereich Gender Medicine und Gender Health und Interviews mit externen Fachpersonen sechs Hauptbereiche herausgearbeitet. Zu diesen sechs Problemfeldern haben wir in Stakeholder-Workshops mit über 60 Personen zusammengearbeitet, darunter sind Fachleute aus der Praxis wie Ärztinnen, Psychologen, Spitex-, Präventions- und Rehabilitationsfachkräfte. Daraus konnten wir Massnahmen ableiten, mit denen sich Defizite in der Gesundheitsversorgung von Frauen beheben lassen könnten.
Wir haben aber auch internationale Studien zum Vergleich herangezogen. Dadurch konnten wir feststellen, dass sich die durch uns identifizierten Defizite in der Schweizer Gesundheitsversorgung mit internationalen Daten decken. Wenngleich andere Länder ebenfalls geschlechtsbezogene Forschungslücken aufweisen.
Der Ausschluss von Frauen und weiblichen Tieren aus der Forschung wird oft damit begründet, dass ihr hormoneller Zyklus Schwankungen bedingt und die Resultate gewissermassen verfälschen könnte. Wie stehen Sie dazu aus wissenschaftlicher Sicht?
Büchler: Die Vorstellung vom ‘störenden’ weiblichen Zyklus hält sich in der medizinischen Forschung hartnäckig. Dabei geht vergessen, dass rund 50 Prozent der Bevölkerung weiblich sind und einen Zyklus haben! Würde man das ernst nehmen, müsste gezielt beforscht werden, wie sich der weibliche Zyklus auswirkt und sich die Variabilitäten in den Daten fassen lassen. Was ja nicht geschieht, wenn man diese Hälfte der Bevölkerung ausklammert. Und dabei haben wir noch gar nicht über den Teil der Bevölkerung gesprochen, der weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuzuordnen ist.
Zweitens ignoriert dieser Glaubenssatz – man könnte fast schon von einem Mythos sprechen – jüngste Forschungsergebnisse, die aufzeigen, dass gewisse biologische Merkmale innerhalb einer rein männlichen Tierpopulation variabler sind als innerhalb einer weiblichen Gruppe. Dies zeigt, dass es entscheidend darauf ankommt, was man untersuchen will und wie man hinschaut.
«Die Vorstellung vom ‘störenden’ weiblichen Zyklus hält sich in der medizinischen Forschung hartnäckig»
Tina Büchler
Dabei ist selbst der Allgemeinheit schon recht bekannt, dass ein Herzinfarkt sich bei Frauen anders äussert als bei Männern und daher bei Frauen häufig zu spät oder gar nicht erkannt wird.
Bigler: Dennoch sagen die von uns befragten Fachpersonen, dass es in der Schweiz immer noch länger dauert, bis bei einer Frau ein Herzinfarkt diagnostiziert wird. Eine Schweizer Studie von 2023 belegt, dass Frauen mit Herzkreislauf-Erkrankungen seltener auf Intensivstationen eingewiesen werden als gleichaltrige Männer, obschon sie ähnliche oder gar schwerere Krankheitsverläufe aufweisen.
Es gibt aber nicht nur in der Diagnostik eine Verzögerung. Die Defizite reichen auch in die Therapie und setzen sich in der Rehabilitation fort: Herzkreislauf-Patientinnen nehmen seltener und kürzer Reha in Anspruch als Männer, obwohl die kardiale Reha die Sterblichkeitsrate und die Zahl an Re-Hospitalisationen senken kann. Mögliche Gründe hierfür sind, dass Frauen seltener eine Reha angeboten wird oder Care-Arbeit sie daran hindert, weil sie eher für Angehörige sorgen, für ihre Kinder oder Eltern zum Beispiel.
Womit wir bei den Geschlechterrollen wären. Warum ist es so wichtig, wie Sie in Ihrem Bericht betonen, nach biologischem Geschlecht und nach dem Gender als sozialem Geschlecht zu differenzieren?
Büchler: Beim biologischen Geschlecht sollte es klar sein, dass die unterschiedlichen körperlichen Gegebenheiten aller Geschlechter im Gesundheitsbereich berücksichtigt werden müssen. Schon hier braucht es aber ein fundamentales Umdenken: Das Gesundheitssystem ist immer noch stark in einem binären Geschlechterkonzept verhaftet, das ausschliesslich von einem männlichen und einem weiblichen Geschlecht ausgeht, weitere Geschlechterformen werden vernachlässigt.
Gender als das soziale Geschlecht ist dem gegenüber sozial angelernt und zeigt sich im Rollenverhalten und in den Geschlechterstereotypen im Kopf – bei Forschenden, Behandelnden und im persönlichen Gesundheitsverhalten.
«Demenz ist ein frappierendes Beispiel für die Wirkmächtigkeit des sozialen Geschlechts»
Christine Bigler
Bigler: Demenz ist ein frappierendes Beispiel für die Wirkmächtigkeit des sozialen Geschlechts. Obwohl Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer, werden demenzielle Erkrankungen wie Alzheimer bei Frauen seltener oder später diagnostiziert. Denn durch ihr Gender sind Frauen kommunikativ gewandter und schneiden in Gedächtnistests besser ab. Wünschenswert wäre daher, die Tests gendersensibel zu gestalten. Das wäre hier ein auf Frauen abgestimmter Demenz-Test.Auch das Beispiel Hautkrebs macht deutlich, wie Gender das Gesundheitsverhalten beeinflusst. Frauen pflegen ihre Haut besser als Männer, sie cremen sich eher ein, gehen in die Massage und zur Kosmetikerin. Deshalb ist bei Frauen die Früherkennung von Hautkrebs besser als bei Männern.
Haben Männer in weiteren Gesundheitsbereichen das Nachsehen – soweit Sie wissen, auch wenn Männergesundheit für die vorliegende Studie explizit nicht in Ihrem Auftrag lag?
Büchler: Ja, bei Depressionen und Brustkrebs beispielsweise. Depressionen sind bei Männern unterdiagnostiziert, weil diese aufgrund vorherrschender Geschlechterbilder eher mit Frauen assoziiert werden. Auch Brustkrebs ist unterdiagnostiziert, weil es bei Männern hoch tabuisiert ist und auch in der medizinischen Praxis als typische Frauenkrankheit gilt. Dabei trifft Brustkrebs in einem von hundert Fällen einen Mann.
Bigler: Für Männer gibt es ausserdem in der Prävention einen grossen Bedarf an gendersensibler Forschung. Aufgrund ihrer Geschlechterrollen nehmen Männer ihren Gesundheitszustand grundsätzlich weniger bewusst wahr und beanspruchen Gesundheitsdienste seltener als Frauen. Um Männer gezielter anzusprechen, sollten auch für sie Prävention und Gesundheitsförderung gendersensibel sein.
«Geschlechterstereotype können Männern grundsätzlich genauso schaden wie Frauen»
Tina Büchler
Büchler: Zusammenfassend lässt es sich so sagen: Geschlechterstereotype können Männern grundsätzlich genauso schaden wie Frauen. Insgesamt aber steht die Benachteiligung von Männern in keinem Verhältnis zur Benachteiligung von Frauen. Der 'Mann als Norm' hat für Frauen deutlich weitergehende Konsequenzen. Es ist aber wichtig festzuhalten: Eine geschlechtersensible Gesundheitsversorgung kommt allen Geschlechtern zugute, nicht nur Frauen.Im zweiten Teil Ihrer Forschungsarbeit haben Sie auf Basis Ihrer Erkenntnisse Vorschläge für Massnahmen formuliert. Welche sind die wichtigsten Empfehlungen zuhanden des BAG?
Bigler: Grundsätzlich braucht es eine Doppelstrategie: Zum Wohle der Frauen und aller Geschlechter sollte im Gesundheitssystem zum einen die spezialisierte Kompetenz in Gender Health und Gender Medicine gefördert und aufgebaut werden. Dieses Wissen muss dann aber auch in die Forschung und Praxis gelangen. Das bedeutet, dass dieses Wissen nicht als zusätzliches ‘Add-on’ behandelt werden darf, sondern als integraler Bestandteil des Gesundheitssystems verstanden werden muss. Integral heisst, dass biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht immer grundlegend mitgedacht werden müssen.
Es braucht also ein Mainstreaming von Genderwissen in allen Bereichen des Gesundheitswesens, einschliesslich der Ausbildung und Weiterbildung in den Gesundheitsberufen. Mit einer zusätzlichen Professur für Gendermedizin ist es nicht getan. Wichtig ist diese Doppelstrategie auch im Hinblick auf die personalized medicine, die sich aktuell international stark entwickelt. Gender Health und Gender Medicine müssen hier einen zentralen Baustein bilden.
«Es braucht also ein Mainstreaming von Genderwissen in allen Bereichen des Gesundheitswesens»
Christine Bigler
Büchler: Eine zentrale Massnahme ist also mehr Grundlagenforschung, gerade auch spezifisch für die Schweiz. Erst so können konkrete evidenzbasierte Massnahmen entwickelt werden. Derzeit fehlen dazu vielerorts die Daten.Ist der NFP 83 – das Ende 2023 ausgerufene Nationale Forschungsprogramm für Gendermedizin und -gesundheit von Schweizerischen Nationalfonds – ein Schritt in diese Richtung?
Büchler: Ja, dieses Forschungsprogramm braucht es unbedingt, es ist ein wichtiger Anfang. Wir begrüssen auch sehr, dass das Programm Gendermedizin und -gesundheit heisst, sich also nicht auf den medizinischen Aspekt beschränkt. Denn um dies noch einmal zu betonen: Neben naturwissenschaftlichen Zugängen muss auch dem sozialen Geschlecht vermehrt Aufmerksamkeit zukommen. Wenn dieses weiterhin vernachlässigt wird, bleibt eine Gleichstellung von Männern und Frauen im Schweizer Gesundheitssystem unerreichbar.
Ein interdisziplinärer Ansatz unter Berücksichtigung von sozialwissenschaftlichen und psychologischen oder auch ökonomischen Zugängen ist deshalb unerlässlich. Wichtig ist auch, dass Massnahmen – etwa in der Prävention – auf die Überwindung hinderlicher Stereotypen zielen.
Enorm wichtig ist eine systematische Vermittlung von geschlechterspezifischem Wissen in der Ausbildung und in der Weiterbildung. Es dauert noch zu lange, bis bereits existierendes Wissen in der Praxis ankommt. Während in der medizinischen Grundausbildung erste Entwicklungen feststellbar sind, konnten wir für andere Berufsfelder im Gesundheitswesen kaum Bewegung feststellen. Auch Weiterbildungen sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden – Personen in hohen Kaderpositionen sind in den oftmals hierarchischen Systemen enorm richtungsweisend und prägen ganze Abteilungen oder Institutionen über Jahrzehnte.
Genauso bedeutend sind strukturelle Veränderungen in der Arbeitswelt des Gesundheitswesens: Es braucht mehr Frauen in den von Männern dominierten Fachbereichen wie Chirurgie, und es braucht sie dort besonders auch in Führungspositionen. Das heisst, dass die Frauenförderung weitergeführt werden muss – und auch das Engagement gegen Sexismus, der in vielen Schweizer Gesundheitsinstitutionen nachweislich allgegenwärtig ist.
Das Bundesamt für Gesundheit hat am 15. Mai 2024 den Forschungsbericht des IZFG auf seiner Webseite publiziert Der Postulatsbericht des Bundesrates, dem der IZFG-Forschungsbericht als Grundlage dient, wurde ebenfalls am 15. Mai auf der Webseite des Bundesamtes für Gesundheit publiziert. Das Postulat von der Nationalrätin Laurence Fehlmann Rielle datiert auf den 21.06.2019. Die Universität Bern hat eine eigene Medienmitteilung zum IZFG-Forschungsbericht unter dem Titel «Frauen sind im Schweizer Gesundheitssystem benachteiligt» veröffentlicht, ebenfalls am 15. Mai 2024. Dr. Christine Bigler ist Senior Researcher und seit 2014 am IZFG der Universität Bern tätig. Ihre Forschungsinteressen gelten vor allem den Themen geschlechterspezifische Gewalt und Gesundheit im globalen Süden und in der Schweiz. Dr. Tina Büchler ist Senior Researcher am IZFG der Universität Bern. Ihre Fachbereiche sind Sozialgeografie, Migration, Queer Studies und Methoden der qualitativen Sozialforschung. Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.Zum IZFG-Bericht
Link zum IZFG-Forschungsbericht «Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten».
Zum Postulatsbericht des Bundesrates
Link zum Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulates 19.3910 Fehlmann Rielle
Zur Medienmitteilung der Universität Bern
«Frauen sind im Schweizer Gesundheitssystem benachteiligt»
Zur Person

Christine Bigler
Zur Person

Tina Büchler
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren