Bildungsforschung
Wer es an die Uni schafft, steht früh fest
Die Laufbahn hängt in der Schweiz nicht nur von der schulischen Leistung ab, sondern auch vom Elternhaus: Kinder aus Akademikerfamilien haben – bei gleichen Leistungen – eine doppelt so grosse Chance auf einen Hochschulabschluss wie Kinder von Nichtakademikern.

«Auf die Frage, wem der Übergang an eine Hochschule gelingt, würden die meisten wahrscheinlich antworten: Es sind die Talentierten und Ehrgeizigen eines Jahrgangs, die durch den Flaschenhals ins Gymnasium und dann durch das Nadelöhr auf die Hochschulen gelangen», sagt Rolf Becker, Professor am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern. Die Aussage lässt schon erahnen, dass die Realität anders aussieht. Die Langzeitstudie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben, siehe Box) der Universität Bern, an der Becker beteiligt ist, zeigt, dass in der Schweiz ein deutlicher Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung besteht: «Kinder von Eltern mit Tertiärbildung haben eine mehr als doppelt so grosse Chance, eine Studienberechtigung und einen Hochschulabschluss zu erwerben, als Kinder von Eltern mit tieferem Bildungsniveau – und das bei gleichen Leistungen», sagt der Bildungssoziologe. Damit befindet sich die Schweiz bei der Offenheit der relativen Bildungsmobilität im Vergleich der OECD-Länder im Mittelfeld.
Studieren in Schnappschüssen
Das Titelbild dieses Artikels erschien erstmals als Teil der Bildstrecke in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. Fünf Studierende der Universität Bern haben alltägliche Momente ihres Studi-Lebens mit einer Instax-Kamera eingefangen. Kuratiert und arrangiert wurden die Bilder von unserem Fotografen Dres Hubacher. Die daraus entstandene Bildstrecke wirft einen ganz eigenen Blick auf die Themen, die im Heft vorkommen.
Hochschulabschlüsse nehmen zu – vor allem von Frauen
Dabei nimmt die Zahl der Studierenden in der Schweiz seit Jahren zu: Gemäss dem Bundesamt für Statistik hat sich die absolute Zahl der Personen, die an einer öffentlichen Universität, Fachhochschule (FH) oder Pädagogischen Hochschule (PH) immatrikuliert sind, in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdoppelt. Und dies, obwohl die durchschnittliche Schweizer Maturitätsquote mit etwas über 20 Prozent im internationalen Vergleich eher tief ist. Dafür besteht im hiesigen Bildungssystem die Möglichkeit, über Berufs- und Fachmaturitätsabschlüsse zu einem Hochschulabschluss zu gelangen. Zum Anstieg der Abschlüsse auf Tertiärstufe haben denn auch vor allem die Fachhochschulen und weniger die Universitäten beigetragen, wenngleich auch sie immer mehr Studierende verzeichnen. Zum Teil liegt das an Personen aus dem nahen Ausland, die vermehrt zum Studium in die Schweiz kommen, vor allem auf Masterstufe. Es sind aber hauptsächlich die jungen Frauen, die zur Bildungsexpansion in der Schweiz beigetragen haben: Sie stellen mittlerweile in den Gymnasien, Universitäten und PHs mehr als die Hälfte der Studierenden.
«Die Kinder sollen mindestens das erreichen, was die Eltern selbst erreicht haben, damit ein sozialer Abstieg vermieden wird.»
Rolf Becker
Obwohl also das Bildungsniveau in der Gesellschaft insgesamt steigt, hat sich in der sozialen Zusammensetzung an den Gymnasien und Universitäten wenig verändert. Dies liegt daran, dass der Erfolg im Schweizer Bildungssystem davon abhängt, wie stark Eltern ihre Kinder unterstützen können. Und hier sind Kinder aus bessergestellten Familien im Vorteil, einerseits finanziell, weil die Eltern die lange Schul- und Studienzeit besser auffangen können. Andererseits spielt auch die Bildungsaspiration eine Rolle, also welchen Bildungsgrad sich die Eltern für ihren Nachwuchs wünschen. «Eltern haben meist eine klare Vorstellung davon, welchen Bildungsweg ihre Kinder einschlagen sollen», erklärt Becker: «Die Kinder sollen mindestens das erreichen, was sie selbst erreicht haben, damit ein sozialer Abstieg vermieden wird. Es liegt auf der Hand, dass die Akademikereltern mehr in die Bildung ihrer Kinder investieren müssen als etwa Handwerkereltern, um dieses Ziel zu erreichen.»
Frühe Selektion wird nur selten korrigiert
Die wichtigste Selektion findet gemäss Becker beim Übergang von der Primarschule in die Stufe Sek I statt. Die Einteilung auf die Leistungsniveaus «Grundanforderungen», «erweiterte Anforderungen» und «hohe Anforderungen» findet in der Schweiz bereits mit etwa zwölf Jahren statt und bestimmt den weiteren Bildungsweg. Die TREE-Studie zeigt in verschiedenen Veröffentlichungen, dass diese frühe Selektion nur selten korrigiert wird, und wenn, dann eher von oben nach unten. Das hat vor allem für Schülerinnen und Schüler auf der Stufe «Grundanforderungen» weitreichende Konsequenzen: Ihnen bleibt nach der obligatorischen Schulzeit meist nur die Berufslehre. Auch bei der Lehrstellensuche sind sie im Nachteil, weil die Lehrbetriebe eher nach Niveau und nicht nach effektiver Leistung auswählen. Will heissen: Schüler aus dem mittleren Leistungszug haben trotz schlechter Noten bei der Lehrstellensuche bessere Chancen als gute Schüler aus dem tiefsten Leistungszug. Diese finden sich nach der obligatorischen Schulzeit besonders häufig in Zwischenlösungen und in Ausbildungen zu Berufen mit geringen Qualifikationen. Kinder aus sozial bessergestellten Familien nehmen hingegen öfter den Weg über die Berufsmaturität.
Bildungsforschung
TREE-Studie
Die Studie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) ist eine Langzeitstudie der Universität Bern. Sie wird seit 2001 am Institut für Soziologie durchgeführt und begleitet Jugendliche auf ihrem Weg ins Erwachsenen- und Arbeitsleben. Die erste Stichprobe (TREE1) besteht aus über 6300 Teilnehmenden der PISA-Studie 2000 und wurde zwischen 2000 und 2014 mehrmals zu ihrem Werdegang befragt. Die zweite Stichprobe (TREE2) wurde 2016 aus der Schulpflicht entlassen und wird seither durch die Studie begleitet.
An den Gymnasien sind die Schüler und Schülerinnen aus bildungsnahem und gut situiertem Elternhaus in der Überzahl: Nur rund ein Viertel der Gymnasiasten hat Eltern ohne höhere Bildung. Welche Hürden sie überwinden müssen, zeigt das Beispiel von Livia Dössegger. Die 26-Jährige hat einen Bachelor in Englisch und Kommunikationswissenschaften und absolviert zurzeit an der Universität Bern ein Hochschulpraktikum. Ihr Vater arbeitete als Carrosseriespengler und unterrichtete an der Berufsschule, ihre Mutter war Hausfrau. «Meine Eltern haben sich nie gross in meine Schulangelegenheiten eingemischt», sagt Dössegger. «Sie vertrauten darauf, dass ich es selbst im Griff hatte.» In der neunten Klasse habe eine Lehrerin sie dazu motiviert, ans Gymnasium zu wechseln. «Ich war unsicher und dachte, es sei einfacher, eine Lehre zu machen. Aber die Noten waren gut. Es gab keinen Grund, nicht ins Gymnasium zu gehen.» Dort sei ihr zum ersten Mal bewusst geworden, dass die meisten ihrer Mitschüler sich viel selbstverständlicher im Schulsystem zurechtfanden als sie. «Meine Eltern haben mich in meiner Entscheidung bestärkt. Aber helfen konnten sie mir nicht. Keiner aus meiner Familie hatte das Gymnasium besucht.» Diese Pionierrolle habe sie damals genervt: «Meine Mitschüler lernten mit ihren Eltern für Matheprüfungen oder gaben ihnen die Aufsätze zum Gegenlesen. Ich war meistens auf mich allein gestellt und musste mich durchfragen.» Auch beim Anmeldeprozess für die Universität seien die meisten in ihrer Klasse von den Eltern unterstützt worden. Im Nachhinein sei sie jedoch stolz, es durchgezogen zu haben. Zwei Cousins haben nun ebenfalls ein Studium begonnen, und ihr Bruder machte nach der Lehre die Berufsmatur und studiert nun an der Fachhochschule. «Ich denke schon, dass mein Vorbild dazu beigetragen hat.»
Zur Person

Rolf Becker
ist Professor für Bildungssoziologie am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Bern und Mitantragsteller der TREE-Studie. Ein Forschungsschwerpunkt ist die soziale Ungleichheit von Bildungschancen, insbesondere die Auswirkungen leistungsfremder Kriterien wie soziale Herkunft oder Geschlecht auf die Möglichkeit, bestimmte Bildungsziele zu erreichen.
Die Zweifel, mit denen Livia Dössegger zu kämpfen hatte, sind typisch für Kinder aus bildungsfernen Haushalten. Bildungssoziologe Becker: «Wir sehen, dass vor allem die Kinder aus der Arbeiterschicht zögern, ein Studium zu beginnen, selbst wenn sie dazu berechtigt sind.» Gleiches gelte für Kinder aus der Mittelschicht mit einer Berufsmaturität. «Entweder fürchten sie, es leistungsmässig doch nicht zu schaffen, oder die erwarteten Kosten halten sie davon ab.» Akademikereltern hingegen können ihre Kinder, selbst wenn diese schwächere Leistungen zeigen, eher durchs Studium navigieren, weil sie das System selbst durchlaufen haben und kennen.
Magazin uniFOKUS

«Startrampe Studium»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Studieren»
uniFOKUS als Magazin abonnierenMaturanote wirkt nach
Der Bildungsbericht 2023 der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung (siehe Box) legt nahe, dass sich die sozialen Ungleichheiten während des Studiums noch verstärken. Studierende mit Eltern ohne nachobligatorischen Bildungsabschluss und Migrantinnen und Migranten der ersten Generation schliessen das Studium seltener erfolgreich ab als Studierende mit Eltern mit Tertiärabschluss oder Personen ohne Migrationshintergrund. «Die soziale Selektion findet jedoch grösstenteils schon früher in der Bildungslaufbahn statt», erklärt Andrea Diem, Co-Autorin des Bildungsberichts. Wer das Gymnasium erfolgreich beendet, hat gute Chancen auf einen Hochschulabschluss. «Fast alle, welche die Matura geschafft haben, treten an eine Hochschule über, die meisten an eine Universität», sagt Diem. Von ihnen schliessen wiederum im Durchschnitt 76 Prozent innerhalb von acht Jahren ein Bachelorstudium ab, wobei die Erfolgsquote bei Fachbereichen mit Eignungsprüfung, etwa Medizin, höher ist. Als wichtiger Faktor für den Studienerfolg erweist sich die Maturanote: Der Bildungsbericht zeigt, dass diejenigen, welche die Matura nur knapp bestanden, das Studium häufiger nicht beenden als diejenigen mit einem guten Abschlusszeugnis.
«Der Bildungsbericht legt nahe, dass sich die sozialen Ungleichheiten während des Studiums noch verstärken.»
Andrea Diem
Wer ein Studium abbricht, tut dies meist innerhalb der ersten zwei Jahre. «Gründe sind häufig nicht erfüllte Erwartungen ans Studium sowie hohe Leistungsanforderungen», sagt Diem. Die Schweizer Universitäten hätten bereits diverse Massnahmen ergriffen, um die soziale und akademische Integration der Studierenden zu verbessern, etwa Selbstlernkurse, Infotage, Online-Selbsttests oder Mentoringprogramme. Beim Studienabbruch können aber auch äussere Faktoren wie der Gesundheitszustand oder die finanzielle Lage der Studierenden eine Rolle spielen, auf die die Universitäten keinen Einfluss haben.
Bildungsforschung
Bildungsbericht 2023
Der Bildungsbericht Schweiz vermittelt Daten und Informationen aus Statistik, Forschung und Verwaltung zum gesamten Bildungswesen der Schweiz von der Vorschule bis zur Weiterbildung. Der Bildungsbericht wird alle vier Jahre von der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung unter der Leitung von Stefan C. Wolter, Professor für Bildungsökonomie an der Universität Bern, neu herausgegeben.
Finanziell lohnt sich ein Studium im Übrigen fast immer, selbst wenn man den späteren Eintritt ins Erwerbsleben berücksichtigt. Die grosse Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen von Universitäten gliedert sich erfolgreich in den Arbeitsmarkt ein. Besonders gute Erwerbschancen haben Absolventinnen und Absolventen der technischen Fachbereiche, Medizin und Pharmazie, während diejenigen der Wirtschaft und Medizin die höchsten Einkommen erzielen.
Zur Person

Andrea Diem
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung in Aarau und Mitautorin des Bildungsberichts 2023. Zu ihren Themenschwerpunkten gehören Bildungsverläufe – namentlich die Übergänge in die Hochschulen und die Studienverläufe – sowie Übergänge in den Arbeitsmarkt.
«Lotterie der Geburt»
Bildungssoziologe Rolf Becker musste sich schon häufiger den Vorwurf anhören, die Daten der TREE-Studie zu negativ zu interpretieren und die Berufslehre als Alternative zum Studium abzuwerten. Darum gehe es aber nicht. Becker: «Heute kann man anhand der sozialen Merkmale schon von Geburt an vorhersagen, welchen Bildungsweg ein Kind einschlagen wird. Also auch den Weg in die Berufsausbildung oder in die Hochschulbildung. Wenn Chancengleichheit gewährleistet sein soll, dann sollte das nicht möglich sein.» Schliesslich könnten Kinder nichts dafür, wenn sie in der «Lotterie der Geburt» schlechtere Karten bekommen hätten.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
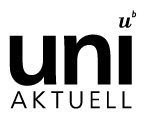
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.


