Migrationsgeschichte
Francesca Falk: Gegen die blendende Evidenz der Gegenwart
Wie eine Gesellschaft das «Wir» definiert und soziale Grenzen zieht, untersucht die Historikerin Francesca Falk in ihrem neuen Buch. Im Interview erläutert sie, wie entgegen der Evidenz – oder Augenscheinlichkeit – der Gegenwart die Geschichtswissenschaft ermöglicht, das Jetzt anders zu sehen.

Francesca Falk: Gegen Evidenz im Sinne von empirischen Belegen habe ich gar nichts! Der Begriff Evidenz weist allerdings verschiedene Bedeutungen auf. Er kann auch Augenscheinlichkeit meinen und damit das bezeichnen, was nicht hinterfragt wird. Eine Geschichtswissenschaft, wie ich sie vertrete, raubt den Dingen ihre Selbstverständlichkeit und dient sozusagen als Sonnenbrille gegen die blendende Augenscheinlichkeit der Gegenwart.
Ist es gar nicht so einfach, aus der Vergangenheit zu lernen?Eine Geschichtswissenschaft, die in die Zukunft weist, geht nicht davon aus, dass wir aus der Vergangenheit durch einfaches Extrapolieren lernen können. Ein solches Verständnis würde der Komplexität historischer Phänomene nicht gerecht werden.
Geschichtswissenschaft, wie Sie sie verstehen, interessiert sich nicht nur dafür, wie die Welt war und ist, sondern auch dafür, wie sie sein könnte. Was meinen Sie damit?Die Geschichte zeigt uns, dass gesellschaftlicher Wandel immer wieder stattgefunden hat. Die jetzigen Verhältnisse sind historisch entstanden und sie sind wie sie sind. Sie könnten aber auch anders sein.
Eine geschichtswissenschaftliche Perspektive ermöglicht uns genau dies: die Gegenwart anders zu sehen. Damit eröffnet sie auch andere Visionen für die Zukunft. Fehlt uns dieses Wissen, werden wir zu Gefangenen des Jetzt. Die Denkvoraussetzungen unseres Zeitalters schränken unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten ein.
Würden Sie dies an einem Beispiel erklären?Eine Genferin, die in Bern lebt, kann hier an kommunalen und kantonalen Wahlen und Abstimmungen teilnehmen. Das war nicht immer so. Dass sie früher hiervon ausgeschlossen gewesen wäre, erscheint aus heutiger Sicht inakzeptabel. Denn heute ist es selbstverständlich, dass sowohl Frauen wie auch Schweizer:innen ohne Ortsbürgerrechte politisch an ihrem Wohnort mitbestimmen können sollen. Eine historische Betrachtung aber kann für den Umstand sensibilisieren, dass Demokratiedefizite von den Zeitgenoss:innen oft nicht als solche wahrgenommen wurden.
«Die Schweiz ist stark durch Migration zu dem geworden, was sie heute ist.»
Francesca Falk
Ich untersuche die Motive und Mechanismen politischer und sozialer Grenzziehungen sowie die vielfältigen Folgen davon. Denn das stete Aushandeln, wer zu einem «Wir» gehört und dementsprechend mit bestimmten Rechten ausgestattet wird, und wer nicht, ist ein grundlegender gesellschaftlicher Prozess. Den Wert dieser Publikation sehe ich zudem vor allem darin, mein Verständnis von Geschichte in gebündelter Form zum Ausdruck zu bringen.
In Ihrer Publikation fordern Sie eine «Migrantisierung der Geschichte» und eine «Entmigrantisierung von Menschen». Wie ist das zu verstehen?In Bezug auf die Migrationsthematik lässt sich ein gewisses Paradox beobachten. Viele Menschen in einer Gesellschaft werden migrantisiert – praktisch aufs «Ausländischsein» reduziert –, indem ihre Zugehörigkeit ständig in Frage gestellt wird, selbst wenn sie eingebürgert sind. Ich fordere, dass diese Menschen wieder «entmigrantisiert» werden.
In welchen Situationen werden Menschen «migrantisiert»?Etwa wenn jemand gewalttätig wurde. Oft werden dann die Ursachen für das Verhalten von Personen, die als «migrantisch» wahrgenommenen werden, in ihrer angeblich differierenden Kultur gesucht. Bei «Einheimischen» hingegen werden alternative Erklärungsansätze herangezogen wie etwa der Verweis auf psychische Krankheiten. Das Verhalten von als ausländisch gelesenen Menschen wird also oft dem «fremden Kollektiv» zugeschrieben, während bei «Einheimischen» individuelle Faktoren die Begründung liefern.
Das gleiche Verhalten wird also jeweils anders erklärt.Genau. Gleichzeitig wird die konstitutive Dimension der Migration oft aus der Geschichte gelöscht. Doch die Schweiz ist stark auch durch Migration zu dem geworden, was sie heute ist, denken wir etwa an Essgewohnheiten, die Landwirtschaft, den Bau der grossen Verkehrs- und Energieinfrastrukturen oder die Erschaffung des Wissens-, Kultur-, Industrie-, Finanz- und Handelsplatzes Schweiz.
«Das Verhalten von als ausländisch gelesenen Menschen wird oft dem ‘fremden Kollektiv’ zugeschrieben, während bei Einheimischen individuelle Faktoren die Begründung liefern.»
Francesca Falk
1970 wurde von den Stimmberechtigten in der Schweiz, damals noch ausschliesslich Männer, die Initiative gegen «Überfremdung», die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, knapp abgelehnt. Rund ein Drittel der ausländischen Arbeitskräfte in der Schweiz – etwa 300’000 Menschen – war damals von der Ausweisung bedroht. Wenn an die Abstimmung über die Schwarzenbach-Initiative erinnert wird, stehen oft nicht sie, sondern der rechtspopulistische Initiator James Schwarzenbach im Zentrum. Uns schien es fünfzig Jahre nach der Abstimmung dringlich, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen.
Sie befragten die von der Initiative betroffenen Menschen?Ja, wir gingen der Frage nach, wie sie die damaligen Debatten erlebten und welche Spuren diese Erfahrungen in ihrem Leben hinterliessen. Einige der Zeitzeug:innen berichteten, dass die Abstimmung sie politisiert habe. Sie erzählten von Gemeinschaften, die sich organisiert und für ihre Rechte gekämpft hatten. Zur Beschreibung dieses Phänomens wählten wir den Begriff «Schwarzenbacheffekt». Ähnliche Tendenzen lassen sich auch bei anderen Initiativen wie der Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» beobachten.
«Eine Wissenschaft, die eine kritische Funktion einnimmt, ist auf demokratische Verhältnisse angewiesen, sonst können die Forschenden an Leib und Leben gefährdet sein.»
Francesca Falk
Gerade in unserem Zeitalter ist mir eine sorgfältige Einführung in die Quellenkritik und in das kritische Lesen wichtig. Dadurch erwerben Studierende Kompetenzen für die generelle Einschätzung von Informationen. Demokratien sind für ihr Funktionieren darauf angewiesen, dass solche Fähigkeiten in der Gesellschaft verbreitet sind.
Eine Wissenschaft, die eine kritische Funktion einnimmt, ist im Übrigen auf demokratische Verhältnisse angewiesen, sonst können die Forschenden an Leib und Leben gefährdet sein. Sie müssen sich folglich unter anderem auch aus wissenschaftlichem Selbsterhaltungsantrieb für «Demokratie» einsetzen. Denn ein Blick in die Geschichte zeigt, dass demokratische Errungenschaften verletzlich sind und stets gefährdet bleiben. Ein Berufsberater hatte Ihnen einst vom Geschichtsstudium abgeraten …Vor meiner Matura schwankte ich zwischen einem Studium der Geschichte und der Rechtswissenschaft. Der Berufsberater riet mir sehr dezidiert vom «zukunftslosen Studium» der Geschichte ab; er meinte, ich könne diesem Interesse ja als Hobby nachgehen. Die Beratung erfüllte ihren Zweck: Danach war ich mir sicher, dass ich Geschichte studieren wollte.
Haben Sie Ihre Studienwahl je bereut?Nein. Es gibt nichts, was nicht auch aus historischer Perspektive betrachtet werden kann. Meiner Neugier überall folgen zu können, entspricht mir sehr.
Medienmitteilung
Historische Grenzziehungen neu denken
Medienmitteilung der Universität Bern zu Francesca Falks neuem Buch vom 10. April 2025: «Historische Grenzziehungen neu denken»
Über Francesca Falk

Francesca Falk ist Dozentin für Migrationsgeschichte an der Universität Bern. Sie hat an verschiedenen Universitäten in der Schweiz und im Ausland studiert, gelehrt und geforscht. Für ihre Publikationen und Lehrtätigkeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Ihr Forschungsinteresse erstreckt sich über ein breites Spektrum sozial- und kulturhistorischer Themen, darunter Migration, Machtstrukturen, gesellschaftliche Konsensverschiebungen sowie public, visual und oral history. Sie ist zudem Vizepräsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte und dort Leiterin der Abteilung Wissenschaftspolitik.
Kontakt: PD Dr. Francesca Falk, francesca.falk@unibe.ch
Angaben zum Buch
Francesca Falk (2025): Gegen die blendende Evidenz der Gegenwart: Geschichte, die in die Zukunft weist.
Das Buch erscheint am 11. April 2025 im Seismo Verlag und «Open Access» (Gratis PDF-Download), Link: https://doi.org/10.33058/seismo.30905
106 Seiten; ISBN 978-3-03777-298-0.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
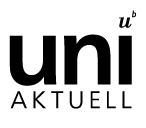
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.


