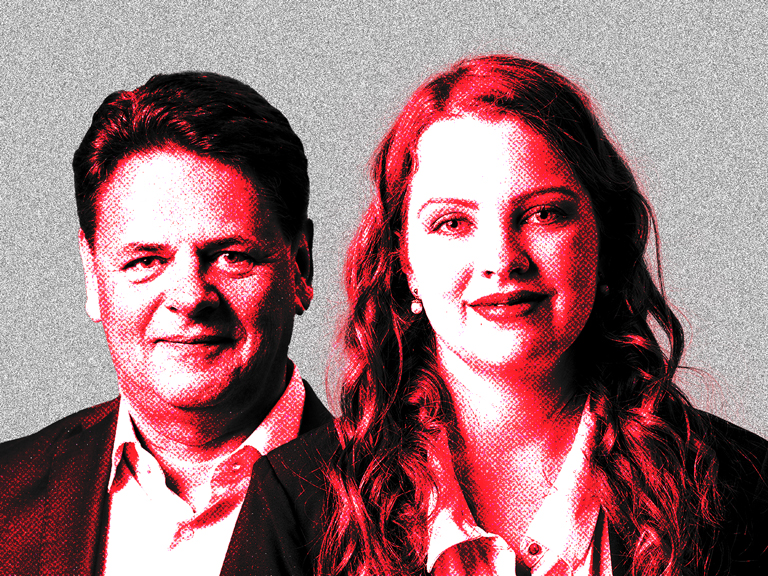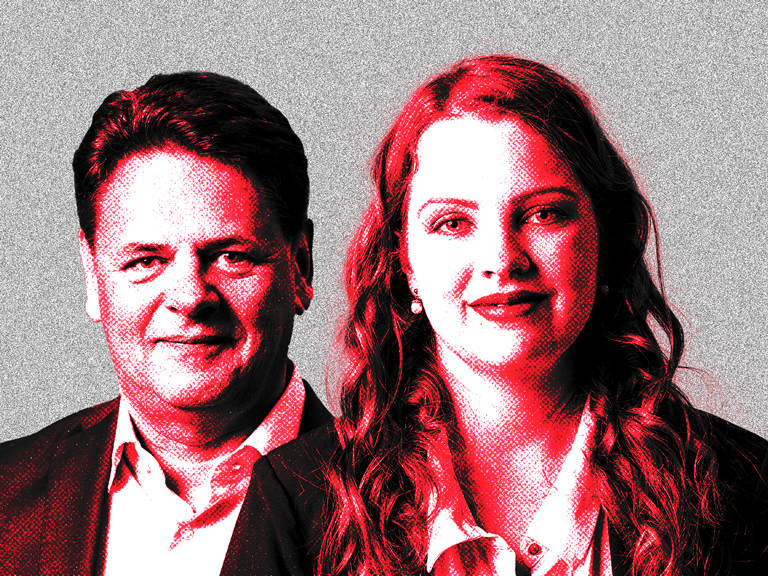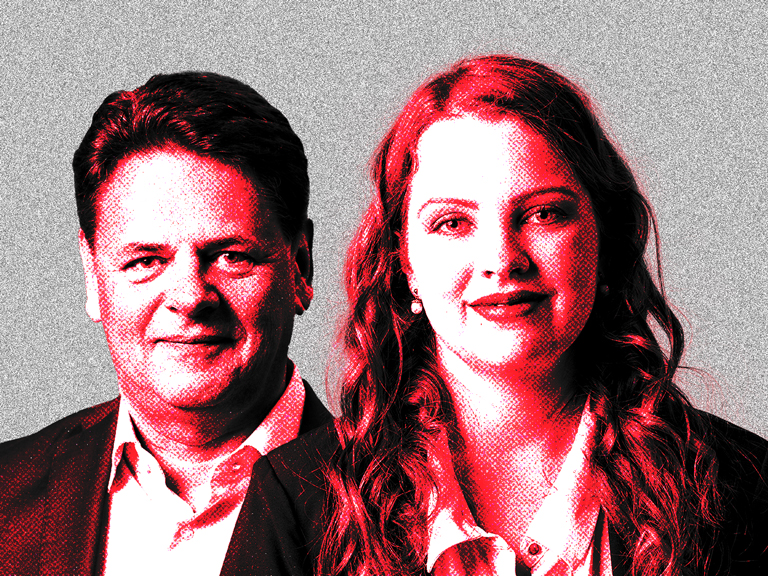Politkolumne
Schweizer Föderalismus – auf dem Weg zum Zentralstaat?
Der Bund befiehlt, bezahlt aber nur unzureichend: Die Machtbalance zwischen Bund und Kantonen gerät aus dem Gleichgewicht.
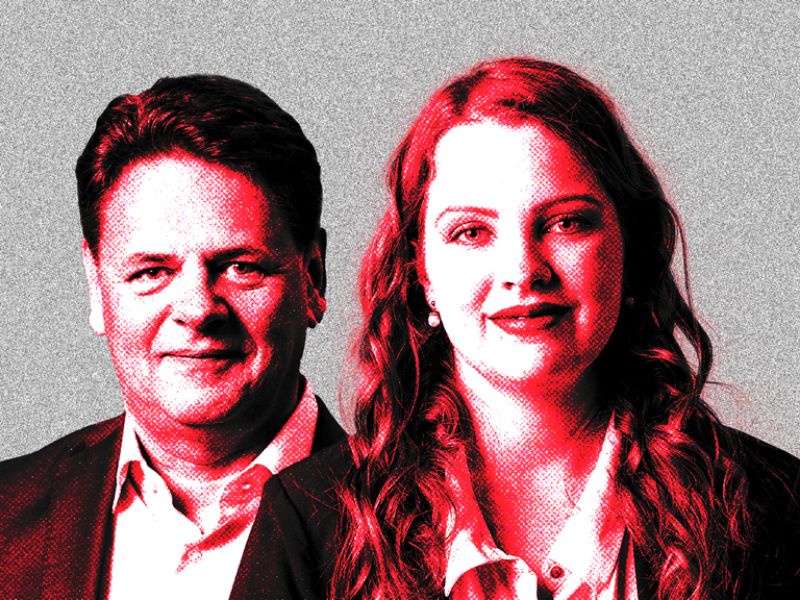
Es knirscht gewaltig im föderalen Gebälk. Selten haben die Kantone ihren Unmut öffentlich so deutlich kundgetan wie Mitte März 2025 in einer Stellungnahme zum Sparprogramm des Bundes. Die Kantonsregierungen empfinden das Vorgehen des Bundesrats beim Entlastungspaket 2027 als «höchst unbefriedigend». Und sie stellen entschieden klar: Die Sanierung der Bundesfinanzen dürfe nicht auf ihre Kosten geschehen.
Nun fürchten die Kantone sogar, dass die Sparmassnahmen des Bundes eines der wichtigsten staatspolitischen Reformvorhaben der letzten Jahrzehnte zerreiben könnten: das Projekt «Entflechtung 27», die gross angelegte, umfassende Überprüfung der Aufgabenteilung von Bund und Kantonen zwecks Stärkung des Föderalismus.
In den Chor der mit der Bundespolitik Unzufriedenen stimmen auch die Gemeinden und Städte ein. So kritisierte der Schweizerische Gemeindeverband kürzlich, dass der Bund auf dem Buckel der Gemeinden spare. Fast zeitgleich wagte der Schweizerische Städteverband die Flucht nach vorne. In seiner Medienmitteilung «Ungehört in Bundesbern?» warnte er den Bund davor, die Städte fortlaufend zu übersteuern – sei es bei Tempo 30 oder den Mindestlöhnen.
Zentralisierung «à trois vitesses»
Die aktuellen Proteste der Kantone, Städte und Gemeinden machen ein altbekanntes Problem sichtbarer denn je: Die bundespolitischen Mitwirkungsrechte der unteren Staatsebenen sind unzureichend und reformbedürftig. Schon die amerikanischen Verfassungsväter wiesen darauf hin, dass sich Autonomie und Mitwirkung – die beiden Pfeiler des Föderalismus – gegenseitig bedingen. Föderalismus lebt nicht nur von eigenständigen Gliedstaaten («self-rule»), sondern ebenso von deren effektiver Teilhabe an nationalen Entscheidungen («shared rule»).
Doch genau diese föderale Machtbalance gerät zunehmend aus dem Gleichgewicht. «Wir können zwar selber Steuern erheben, aber kaum mehr selbst bestimmen, was wir damit anfangen wollen», sagen Regierungsräte hinter vorgehaltener Hand.
Woher rührt dieser Föderalismusschwund in unserem urföderalen Staat? Seit seiner Gründung fährt der schweizerische Bundesstaat auf einer Einbahnstrasse, wie eine noch unveröffentlichte Studie der Politologen Sean Mueller und Paolo Dardanelli für den Zeitraum 1848 bis 2020 eindrücklich belegt. Mithilfe zahlreicher Experten haben sie die Kompetenzen von Bund und Kantonen in 22 Politikfeldern erhoben. Das Ergebnis ist eindrücklich: In nahezu allen Bereichen drängt der Bund stetig vor – selbst in einst sicher geglaubten kantonalen Hoheiten wie der Gesundheitspolitik.
In den letzten knapp 180 Jahren wuchs die Macht des Bundes zwar langsam, aber kontinuierlich und bisher unaufhaltsam an. Dabei betraf das «Schreckgespenst Zentralisierung» laut Studienautoren vor allem die Gesetzgebung. Hingegen blieb die fiskalische Autonomie nahezu unberührt. Der Anteil der kantonalen Eigenmittel etwa aus direkten Steuern, Abgaben oder Konzessionen ist weiterhin hoch, während die Bundeszuschüsse an die Kantone auf einem sehr moderaten Niveau verharren.
Kostspielige Umsetzung nationaler Vorgaben
Auch die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen veränderte sich seit 1848 diametral. Einst hatten Bund und Kantone klare, voneinander getrennte Aufgaben. Es war ein Nebeneinander, kein Miteinander – so wie wir es traditionell aus dem US-Föderalismus kennen.
Mit der Zeit hat sich die Schweiz aber immer stärker dem deutschen Verwaltungsföderalismus angenähert: Heute macht der Bund immer häufiger nationale Vorgaben, die die Kantone kostspielig umsetzen müssen. Oder etwas zugespitzt: Der Bund befiehlt, bezahlt aber nur unzureichend. Dies verletzt den Verfassungsgrundsatz der fiskalischen Äquivalenz.
Insgesamt verwandelte sich die Schweiz laut den beiden Autoren in ein eigenartiges Gefüge: In Sachen Kompetenzteilung zwischen Bund und Kantonen ähneln wir zunehmend dem deutschen Modell, während die hiesigen Gliedstaaten wie die kanadischen Provinzen oder US-Bundesstaaten fiskalpolitisch immer noch sehr eigenständig sind.
Es fehlt den Kantonen jedoch an wirkungsvollen, gesetzlich verankerten Mitwirkungskanälen, um sich in der Bundespolitik Gehör zu verschaffen – und sich so gegen eine weitere Aushöhlung des Föderalismus zu stemmen.
Zu viele Vorgaben, zu wenig Mitwirkung
Zu viele Vorgaben, zu wenige Bundesmittel und vor allem keine direkte Mitsprache: Kein Wunder, sind die Kantone unzufrieden. Und kein Wunder, dass die Kantone seit längerem versuchen, ihre bundespolitischen Anliegen auf anderem Weg durchzusetzen – weitgehend unabhängig von den in der Bundesverfassung vorgesehenen Föderalismusinstitutionen.
So wurde erstens die Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) ins Leben gerufen, die es den Kantonen ermöglicht, sich «gezielt und abgestimmt in die Bundespolitik einzubringen». Zweitens intensivierten sie die interkantonale Zusammenarbeit mittels Konkordaten, um Zentralisierungsschüben zuvorzukommen.
Drittens wird als «Ultima Ratio» mit dem Kantonsreferendum gegen missliebige Beschlüsse des Bundesparlaments gedroht. Viertens greifen die Kantone heute notgedrungen auf die vielfältigsten Strategien und Taktiken des professionellen Lobbyings zurück, wobei die Mitwirkung der Kantone an der Willensbildung des Bundes in Art. 45 BV ausdrücklich vorgesehen ist.
Doch all diese Bemühungen ändern nichts am Grundproblem: der fehlende direkte Zugang der Kantonsbehörden in die Bundespolitik. So hat die KDK schon vor zehn Jahren einen Bericht zum Einbezug der Kantone in die Gesetzgebung des Bundes erstellen lassen. Die Expertenstudie fordert, dass die Kantone bei jedem Bundesvorhaben frühzeitig, sachgerecht und chancengleich mitsprechen sollen. Nur so können die Kantone ihr exklusives «Vollzugswissen» einbringen, ohne welches die Erlasse des Bundes später gar nicht umgesetzt werden können.
Der Bund solle die Kantone als gleichwertige Partner behandeln, nicht als irgendeinen partikularen Interessenvertreter. Zudem solle die Zusammenarbeit von Bund und Kantonen regelbasiert ablaufen und, wo immer möglich, sich in einer gemeinsamen Projektorganisation verstetigen, wie es etwa die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, der Sicherheitsverbund Schweiz, die Digitale Verwaltung Schweiz oder auch das Reformvorhaben «Entflechtung 27» vormach(t)en. Auf die Umsetzung der übrigen Empfehlungen warten die Kantone derweil bis heute.
Zweitveröffentlichung
Tamedia-Kolumnen auf uniAKTUELL
Die Tamedia-Politkolumnen von Adrian Vatter und Rahel Freiburghaus sowie Markus Freitag erscheinen auch im Online-Magazin der Universität Bern uniAKTUELL.
Zum Institut für Politikwissenschaft (IPW) der Universität Bern
Das IPW ist eines der führenden politikwissenschaftlichen Institute der Schweiz. Es betreibt sowohl Grundlagenforschung als auch praxisrelevante Auftragsforschung. Deren Kernaussagen sind Bestandteil der angebotenen Studiengänge Bachelor «Sozialwissenschaften» und Master «Politikwissenschaft» sowie des schweizweit einzigartigen Studiengangs «Schweizer Politik im Vergleich». Schwerpunkte in Lehre und Forschung sind Politische Institutionen und Akteure, Europäische Politik, Klima, Umwelt und Energie, Öffentliche Meinung sowie Gender in Politik und Gesellschaft. Darüber hinaus bietet das IPW Dienstleistungen für die Öffentlichkeit an, wie zum Beispiel das Jahrbuch Schweizerische Politik (Année Politique Suisse).
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
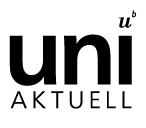
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.