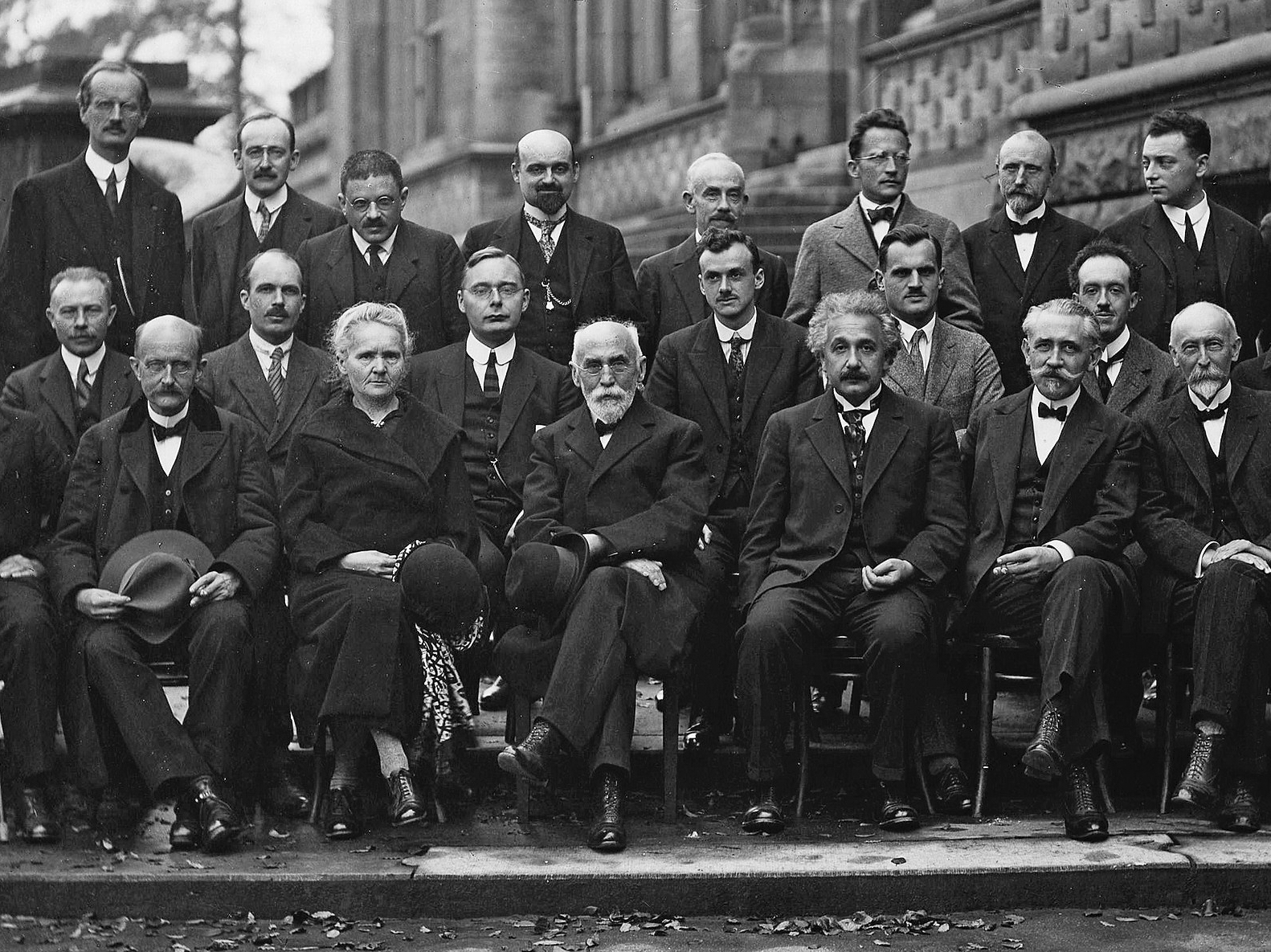Geschlechterrollen
Erst als Frau, dann als Mann im Berufsleben
Wie ist es, als Frau oder als Mann im Wissenschaftsbetrieb tätig zu sein? Der Rechtswissenschaftler Martin Föhse kennt beide Geschlechterrollen: Er hat zehn Jahre als Frau gelebt, in dieser Zeit doktoriert und gelehrt. Seit einigen Jahren lebt er wieder als Mann.

Martin Föhse: Es fühlt sich schon anders an, ob man als Frau oder als Mann unterwegs ist. Insbesondere sind die Erfahrungen, die ich in der sozialen Interaktion machte, unterschiedlich. Da ich nicht als Transfrau aufgetreten bin, sondern einfach als Frau, habe ich das «Frausein» und den Unterschied zum «Mannsein» wahrscheinlich ziemlich authentisch erlebt. Ich wurde im Alltag als Frau klar anders behandelt denn als Mann. Das ist sehr prägend. Da ich nicht auffallen wollte, musste ich in der Konsequenz auch mein Verhalten adaptieren – auf jenes, das von mir als Frau erwartet wurde. Womit wir bereits zur grossen Frage gelangen: Wie stark wird das Geschlecht im weiteren Sinne – sprich Gender – durch die Biologie und wie stark durch die Gesellschaft und deren Erwartungen geprägt, die durch das soziale Umfeld und durch teilweise tief sitzende Gewohnheiten und Rollenvorbilder ebenfalls einen erheblichen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben? Ich vermute, es ist eine Mischung von beidem.
Wie fühlen sich die unterschiedlichen Geschlechterrollen im Wissenschaftsbetrieb an?Den unmittelbaren Vergleich kann ich natürlich nicht ziehen. Ich weiss nicht, wie ich dieselben Begebenheiten in meiner Zeit als Frau an der Universität St. Gallen (HSG) als Mann erlebt hätte. Es ist immer nur ein Vergleich über die Zeit, mit unterschiedlichen Begegnungen und in unterschiedlichen Kontexten. Aber ich glaube trotzdem, dass es erhebliche Unterschiede gibt.
Erzählen Sie aus der Zeit, in der Sie eine Frau waren.Zunächst war ich im Bundesamt für Energie tätig, zuletzt fünf Jahre als Rechtsdienstleiterin. In dieser Zeit verfasste ich berufsbegleitend meine Dissertation an der Universität Bern, meiner Alma Mater. Im Jahr 2016 wurde ich Assistenzprofessorin für Staats- und Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Energierecht an der HSG.
Wir waren damals drei Assistenzprofessorinnen und drei Assistenzprofessoren, die mehr oder weniger gleichzeitig eine jeweils auf fünf Jahre befristete Assistenzprofessur angetreten haben. Allesamt ohne «Tenure Track», also ohne Zusicherung auf Festanstellung unter «Bewährung». Das war auch der Grund, weshalb ich einen Fuss in der Advokatur behielt und parallel zu Lehre und Forschung weiterhin als Anwältin praktizierte.
Magazin uniFOKUS
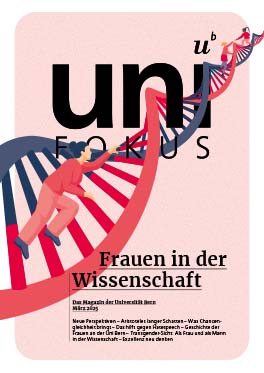
«Frauen in der Wissenschaft»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Frauen in der Wissenschaft»
uniFOKUS als Magazin abonnierenIn der Law School – so nennt sich die rechtswissenschaftliche Fakultät an der HSG – waren und sind die Frauen auf Stufe der ordentlichen Professuren nach wie vor untervertreten. Die HSG stand deshalb unter einem gewissen Druck, Frauen zu berufen. Ich kann mich an die Berufung eines Mannes erinnern, die in der Presse eine heftige Polemik ausgelöst hat, weil keine Frau gewählt wurde.
Im akademischen Umfeld eine Frau zu sein, hat nach meinem Dafürhalten in jenem Umfeld, in dem ich mich bewegte, also eher geholfen als geschadet.
Inwiefern war es anders, als Frau und nicht als Mann vor Studierenden zu stehen?In vielem zeigte sich kein Unterschied. Insbesondere haben die Studierenden gleich gut mitgemacht und ich hatte auch nicht den Eindruck, als habe man mir im einen oder anderen Fall weniger respektive mehr Respekt entgegengebracht. Während des Unterrichts war ich ohnehin in den Stoff vertieft, sodass kaum anderweitige Gedanken aufkamen.
Ich fühlte mich als Frau, was mein Äusseres betrifft, aber stärker beobachtet denn als Mann. Vor Studierenden steht man auf dem Präsentierteller. Gerade das weibliche Publikum kann unerbittlich sein, wenn man sich einen stilistischen Fauxpas leistet. Das führte dazu, dass ich mich durchaus ein wenig unter Druck fühlte, was meine Garderobe und mein Äusseres betraf. – Während ich das sage, merke ich gerade, wie klischiert das klingt, doch es war so. Als Mann war und bin ich in dieser Hinsicht wesentlich entspannter unterwegs.
Wie haben Sie das «Frausein» im ausserakademischen Berufsumfeld erlebt?Gleich vorweg: Auch hier handelt es sich um meine persönlichen Eindrücke – mit Verallgemeinerungen muss man vorsichtig sein.
Ich war als Frau in einer von Männern dominierten Branche unterwegs, der Energiebranche. Als Frau, noch dazu als Anwältin und Professorin, stach ich aus der Masse heraus. Ich erhielt Anfragen für Verwaltungsratsmandate, Aufsichtsgremien und Führungspositionen, für die ich seinerzeit als Mann im gleichen Alter wohl kaum Angebote erhalten hätte. Headhunter nahmen in meinen Jahren als Frau jedenfalls häufiger Kontakt zu mir auf als danach – trotz identischem CV und denselben Qualifikationen. Meiner Erfahrung nach hatte das «Frausein» Vor-, aber auch Nachteile.
Können Sie ein Erlebnis erläutern, das diesen Vorteil als Frau illustriert?Ja, allerdings in umgekehrter Weise: Eine Absage für eine spannende Stelle war für mich besonders schmerzhaft. Sie erfolgte, nachdem ich mitgeteilt hatte, dass ich in ein paar Monaten wieder als Mann auftreten würde. Die entsprechenden Worte am Telefon werde ich nie vergessen: «Es war eigentlich alles gut, aber Sie sind ja dann wieder ein Mann. Wir brauchen eine Frau.»

Die Aussage war entlarvend. «Frausein» entpuppte sich als rein formales Kriterium, «just to tick the box». Es ging nicht um Diversität oder darum, andere Lebenserfahrungen, eine andere Sichtweise auf die Dinge in ein Gremium einzubringen. Das hätte ich ja durchaus mitgebracht. Es ging offensichtlich nur um die Erfüllung einer Quote. Ich kann mir vorstellen, dass diese Haltung kein Einzelfall ist.
Sie fühlten sich also als «Quotenfrau»?Dieser Gedanke kam mir manchmal tatsächlich. Ich musste mir den Vorwurf sogar einmal, wenn auch durch die Blume, von einem Kollegen anhören, nämlich damals, als ich im Bundesamt für Energie nach nur etwas mehr als einem Jahr zur Sektionschefin befördert wurde. Das hat mich zuerst sehr verletzt. Danach sagte ich mir einfach, was soll’s? Ich hatte eine Chance bekommen, mich zu beweisen, und war entschlossen, diese Chance zu nutzen.
Haben Sie weitere Unterschiede als Frau im Berufsleben erlebt?Als Frau hatte ich nicht selten den Eindruck, unterschätzt zu werden. So fragte mich ein neuer Kollege etwa, ob ich im Sekretariat arbeite. Damals leitete ich bereits einen Rechtsdienst. Ich erinnere mich zudem an eine Besprechung, bei der das Gegenüber fast nur meinen neben mir sitzenden Mitarbeiter ansah und mich zunächst ignorierte. Als er dann realisierte, dass ich die Chefin bin, war ihm dies augenscheinlich peinlich.
Ein anderes Mal wollte jemand – notabene kein Jurist – mit mir über die Auslegung eines Gesetzestextes diskutieren und zeigte sich ziemlich hartnäckig. Als ein anderer Kollege ihn darauf hinwies, dass ich es war, die das Gesetz geschrieben hatte, wurde er dann ganz still.
«Meiner Erfahrung nach war es als Frau deutlich heikler, direkt zu sein, gerade Männern gegenüber.»
Martin Föhse
Als Frau war es einfacher, mit höhergestellten Männern ins Gespräch zu kommen. Interessanterweise sprach man dann aber weniger übers Geschäft oder über politische Fragen. Es ging vielmehr um private Dinge. Das habe ich als Mann so nicht erlebt. In meiner Wahrnehmung hat mich dies beruflich aber nicht vorangebracht.
Umgekehrt hatte ich wiederum den Eindruck, dass mir die Akquise für die Anwaltstätigkeit als Mann einfacher gefallen ist. Hier war ich als Mann vielleicht im Vorteil. Das ist aber nur ein subjektiver Eindruck, ich kann selbst nicht klar sagen, wieso sich das für mich so anfühlte.
Es irritiert, wie sehr sich Klischees halten.Ein spezielles Erlebnis war einer meiner ersten Auftritte als Frau vor einem grösseren Publikum. Dabei handelte es sich um einen Vortrag bei einem Verband aus der Energiebranche. Fast alles gesetztere Herren, Altersdurchschnitt wohl Mitte 50. Mir wehte auf der Bühne zunächst ein eisiger Wind entgegen. Nach dem Vortrag wurde ich dann aber mit überschwänglichem Lob überhäuft. Beides war unangemessen. Das war der Moment, in dem ich gelernt habe, dass es auch nützlich sein kann, unterschätzt zu werden. Man kann das sehr wohl zu seinem Vorteil nutzen.
Wie haben Sie als Frau Formen der Diskriminierung erlebt?Es gab Momente, in denen ich mich als Frau benachteiligt fühlte. Das Unterschätzt-Werden kann einen sehr belasten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Karrieren von Frauen auch deshalb nicht vorangehen. Manchmal amüsierte es mich auch, beispielsweise wenn mein Gegenüber ins «Mansplaining» verfiel (Bezeichnung dafür, dass ein Mann davon ausgeht, er wisse mehr über den Gesprächsgegenstand als das – meist weibliche – Gegenüber) oder sich vor mir aufplusterte und seine Meriten ausbreitete. Eine völlig neue Erfahrung für mich. Mit der Zeit begann mir das aber ziemlich auf die Nerven zu gehen.
Es gab aber auch explizitere Episoden: An einem gesellschaftlichen Anlass musste ich einmal einen kleineren Übergriff eines Politikers über mich ergehen lassen. Das ging zu weit. In einem Bewerbungsgespräch musste ich mir auch einmal die Frage anhören, wie es denn mit der Familienplanung aussehe.
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
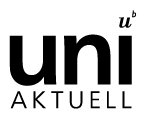
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Als Frau sah ich mich auch mit anderen gesellschaftlichen Erwartungshaltungen konfrontiert. Manchmal war das sehr subtil, manchmal ganz unverblümt. So hatte ich beispielsweise das Gefühl, ich müsse mich ständig dafür entschuldigen, keine Kinder zu haben. Als Mann ist das kein Thema.
Als welches Geschlecht wurden Sie sozialisiert?Als Mann. Ich bin in den 1980er-Jahren als Junge auf dem Land aufgewachsen und erst als 30-Jähriger habe ich mich entschlossen, mein Geschlecht anzugleichen.
In diesem Alter hatte ich als Frau deshalb wohl einen Habitus, der eher männlich war. Deswegen würde ich sagen, dass ich als Frau eine vielleicht ungewöhnlich direkte und fordernde Art hatte. Ich musste auch aufpassen, dass ich das Etikett «tough» erhalte und nicht «Reibeisen». Der Grat war allerdings ziemlich schmal. Meiner Erfahrung nach war es als Frau deutlich heikler, direkt zu sein, gerade Männern gegenüber.
Was möchten Sie jungen Menschen mitgeben, die zu ihrem biologischen Geschlecht ähnliche Fragen haben wie Sie?Es ist wichtig, dass sich Betroffene professionell begleiten lassen. Mir bereiten die steigenden Zahlen in Bezug auf Transgeschlechtlichkeit bei jungen Menschen gewisse Sorgen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen sollte gut abgeklärt und nichts überstürzt werden. Bei der Begleitung Minderjähriger bedarf es aber eines Perspektivenwechsels. Im öffentlichen Diskurs begegne ich oft der Haltung, dass man auf keinen Fall früh in die natürliche biologische Entwicklung eingreifen sollte. Exakt diese Haltung ist ein Problem. Sie übersieht, dass bei «echten» Transgendern genau diese natürliche Entwicklung in der Pubertät ebenfalls zu irreversiblen Konsequenzen führt. Das war beispielsweise bei mir der Fall und ist ein wesentlicher Grund dafür, weshalb ich äusserlich wieder als Mann auftrete. Pubertätsblocker sind also – richtig eingesetzt – ein Segen. Deren Anwendung setzt jedoch eine professionelle Begleitung und eine sorgfältige Abklärung der Motive voraus.
Abgesehen davon: Seid selbstkritisch, aber auch selbstbewusst – und geht euren Weg.
Zur Person

Martin Föhse
ist promovierter Jurist und Rechtsanwalt. Er studierte an der Universität Bern und lebte zehn Jahre als Kathrin Föhse. Kathrin Föhse war zunächst im Bundesamt für Energie (BFE) tätig, davon fünf Jahre als Rechtsdienstleiterin. Danach wechselte sie an die Universität St. Gallen (HSG), wo sie eine Assistenzprofessur für Staats- und Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Energierecht innehatte. Parallel dazu praktizierte sie als Anwältin bis 2024. Nunmehr ist Martin Föhse Vizedirektor des Bundesamts für Polizei fedpol. Er verfügt über einen Lehrauftrag für Energierecht an der Universität Bern.