Chancengleichheit
Wissenschaft und Familie: Neue Wege zur Vereinbarkeit
Die Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere ist mit hohen Hürden und Opfern verbunden. Junge Ärztinnen und Forscherinnen wollen dies ändern, unterstützt von Initiativen, die bessere Rahmenbedingungen schaffen wollen.

Sie sind Ärztinnen, Forscherinnen und Mütter; sie haben drei Jobs gleichzeitig und stehen überall unter Druck: Neben der Care-Arbeit und einem anstrengenden Klinikalltag müssen sie als Wissenschaftlerinnen möglichst viel und fundiert publizieren und Drittmittel einwerben. Anne Gregor von der Initiative «Female Empowerment in Life Science (FELS)» glaubt nicht an einfache Lösungen, um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu verbessern. Doch es gebe viele Schrauben, an denen man drehen könne. «Vor allem müssen alle umdenken: die Universität als Arbeitgeberin, Förderer und Geldgeber wie der Nationalfonds, aber auch wir Mitarbeitenden.»
Fehlende Flexibilität bremst Frauen aus
Das Netzwerk FELS setzt sich für die Karriereentwicklung von Frauen und die Erhöhung ihres Anteils in Führungspositionen ein, vor allem in der Medizin. Auch wenn Anne Gregor selbst nicht Mutter ist, kennt sie deren Mehrfachbelastung: Da wären etwa die Vorträge und Kolloquien, die auch dem Knüpfen des wissenschaftlichen Netzwerks dienen, die jedoch ausserhalb der Kernarbeitszeiten stattfinden. Um an der Universität Bern an der medizinischen Fakultät habilitieren zu können, sollte man zudem ein Jahr im Ausland gewesen sein – doch wie organisiert man das mit einer Familie? Und was ist, wenn das Kind krank ist?
uniAKTUELL-Newsletter abonnieren
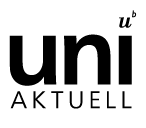
Entdecken Sie Geschichten rund um die Forschung an der Universität Bern und die Menschen dahinter.
Anne Gregor findet es richtig, wenn jüngere Forscherinnen mehr Flexibilität einfordern. Es brauche dringend flexiblere Arbeitszeitmodelle. Doch fragten Mütter und Schwangere danach, würden sie oft weniger gefördert als ihre männlichen Kollegen, die Vollzeit verfügbar sind. Die Folge davon: Werdende Mütter verschweigen ihre Schwangerschaft, bis sie unübersehbar wird, um beispielsweise möglichst lange operieren zu können. Die Vorgesetzten glaubten manchmal, die Frauen mit ihrem Handeln zu schützen, sagt Gregor. «Aber das ist übergriffig: Schwangere sollen selbst entscheiden, bis wann sie weiterarbeiten.»
Viele junge Ärztinnen steigen aus
Karriere und Familie zu vereinbaren, ist in allen Bereichen eines Hochschulbetriebs herausfordernd – in der Medizin kommt hinzu, dass die Ausbildungszeit besonders lang ist. «Man ist etwa 10 bis 15 Jahre im System, bis man Ärztin ist», gibt Anne Gregor zu bedenken. Dazu kommen die überdurchschnittlichen Arbeitszeiten – in Bern gilt die 50-Stunden-Woche für Assistenzärztinnen und -ärzte – und der Schichtdienst. Schon von Beginn des Studiums an ist der Drop-out bei Frauen hoch. «Aber als Gesellschaft können wir es uns schlicht nicht leisten, das Potenzial von Frauen als Führungskräfte nicht zu nutzen», sagt Gregor – auch mit Blick auf den Fachkräftemangel.
Bessere Rahmenbedingungen nötig
Wissenschaft werde nie ein Nine-to-five-Job sein, meint Anne Gregor. Es brauche eine ordentliche Portion Eigenmotivation und Antrieb, um Ärztin und Forscherin gleichzeitig zu sein. «Manchmal muss man in den sauren Apfel beissen und auch mal am Sonntagmorgen im Labor stehen», räumt sie ein. «Wir müssen dringend die Voraussetzungen schaffen, dass Frauen diese Leistung erbringen können – und trotzdem nicht von der Klinikarbeit aufgefressen werden. Denn stimmen die Rahmenbedingungen, sind auch die Frauen gewillt, diesen Extraschritt zu gehen.»
Gregor hat beobachtet, dass Mütter oft sehr effizient arbeiten: Sie haben wenig Zeit und diese müssen sie optimal nutzen. «Allerdings hat Forschung auch viel mit Nachdenken und Kreativität zu tun. Und das lässt sich nicht erzwingen.» Man brauche Forschungsfreiräume, um erfolgreich Wissenschaft zu praktizieren. «Hilfreich ist etwa eine <Protected Research Time>: Das sind Forschungszeiten, in denen Mitarbeitende aus dem Klinikalltag freigestellt werden, um sich zum Beispiel einen Tag pro Woche komplett auf die Forschung fokussieren zu können.» Solche Angebote müssten ausgebaut und es sollte darauf geachtet werden, dass sie im Klinikalltag dann wirklich eingehalten werden. Denn springen Mütter in Notfällen in der Klinik ein, geht ihnen die Zeit oft an ihrer Forschungszeit ab.
«Als Gesellschaft können wir es uns schlicht nicht leisten, das Potenzial von Frauen als Führungskräfte nicht zu nutzen.»
Anne Gregor
Wissenschaftskultur muss sich verändern
Andrew Chan, Vizerektor Internationales und Akademische Karrieren, sagt es klipp und klar: «Das heutige Modell der Wissenschaftskultur ist nicht mehr zeitgemäss.» Würde sich die Gleichstellung verbessern, wenn wir weniger leistungsorientiert wären? Chan winkt ab: «Wissenschaft steht im Spannungsfeld zwischen Qualität und dem Wettbewerb um Mittel. Leistung wird immer zentral sein.» Verändern könne man aber etwas beim Timing: Das Lebensalter, in dem die wissenschaftliche Karriere nach gängigen Kriterien abheben sollte, sei oftmals auch das Alter, in dem die Familienplanung und die Kinderbetreuung viel Raum einnehmen. «Wenn wir es schaffen, diese zwei Lebensabschnitte etwas zu entzerren, würden wir die Energie und das Talent zum jeweils optimalen Zeitpunkt kanalisieren», sagt Chan.
Karriere mit 45? Warum nicht!
Das sieht Anne Gregor genauso: «Eine wissenschaftliche Karriere kann auch noch mit 45 Jahren, wenn die Kinder grösser sind, volle Kraft aufnehmen.»
Auch aus eigener Erfahrung ist Andrew Chan überzeugt, dass Menschen mit vielfältigen Karrieren und unterschiedlichen Lebensgeschichten eine Organisation wie etwa die Universität erfolgreicher machen. Deshalb will auch er Frauenkarrieren in der Wissenschaft fördern: «Wir möchten, können und müssen.» Mit mehreren Initiativen sei man bereits auf gutem Weg, erklärt Chan, etwa mit der «Better Science Initiative» (siehe Interview) oder mit globalen Verbünden von Forschungseinrichtungen und -organisationen, die einen Kulturwandel in der Forschungsbewertung erreichen möchten. Chan verweist auch auf den 120%-Care-Grant der Universität Bern, der es ermöglicht, den Anstellungsgrad befristet zu reduzieren und eine Supportperson anzustellen. Und er nennt «COMET», ein Programm mit Mentoring, Coaching und Training für Postdoktorandinnen. «Das Hauptproblem liegt darin, dass sich die Mechanismen in der Forschung nur sehr langsam verändern.» Mit Besorgnis beobachtet Chan zudem die Sparzwänge, die auf die Hochschulen zukommen: «Wir müssen uns alle dafür starkmachen, dass wir die gegenwärtigen Programme zur Chancengleichheit zumindest im selben Umfang weiter finanziell fördern können.»
Magazin uniFOKUS

«Frauen in der Wissenschaft»
Dieser Artikel erschien erstmals in uniFOKUS, dem Printmagazin der Universität Bern. uniFOKUS beleuchtet viermal pro Jahr einen thematischen Schwerpunkt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Aktuelles Fokusthema: «Frauen in der Wissenschaft»
uniFOKUS als Magazin abonnierenMänner müssen Teil der Lösung sein
Seit 1990 leistet die Universität Bern institutionelle Arbeit im Themengebiet der Gleichstellung; damit ist sie eine Pionierin in diesem Gebiet – etwa mit der Abteilung für Chancengleichheit (siehe Interview). Auch die Mittelbauvereinigung der Universität Bern (MVUB) beschäftigt sich mit dem Thema Vereinbarkeit und organisiert dazu immer wieder Veranstaltungen. Wie Andrew Chan verweist auch die MVUB auf den 120%-Care-Grant. Zudem schlägt sie zusätzliche Instrumente vor, wie sie etwa die Universität Basel mit «get on track» oder «stay on track» kennt. Mit diesen Mechanismen können wahlweise Unterstützungsgelder für die Kinderbetreuung oder eine Hilfskraft für ein Semester finanziert werden.
Interview zum Thema
«Exzellenz neu denken»
Damit wissenschaftliche Karriere und Familie besser miteinander zu vereinbaren sind, soll Exzellenz an der Universität neu gedacht werden. Das fordert die «Better Science Initiative», erklärt Heike Mayer, Mitinitiantin und Vizerektorin der Universität Bern.
Dass das Thema Vereinbarkeit oft immer noch ein «Frauenthema» ist, empfindet MVUB-Co-Präsidentin Bettina Zimmermann als ein Kernproblem: «So wird sich nie etwas ändern. Ohne die Väter ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie überhaupt nicht denkbar.» Dies sieht auch Anne Gregor so: «Ohne ein unterstützendes Umfeld mit dem richtigen Partner ist es schwierig.» Und wie sieht es mit den forschenden Vätern aus? In geringer Anzahl gebe es durchaus Wissenschaftler, die sehr involviert seien in die Familienarbeit, stellt Gregor fest. «Sie haben es dann ähnlich schwer mit der Vereinbarkeit wie die Frauen. Doch während den Müttern ihre Leistungsfähigkeit bei der Arbeit eher abgesprochen wird, werden die Väter dafür bewundert, dass sie beides managen.»
Neue Generation fordert Wandel
Aus Sicht der MVUB braucht es noch einiges für eine bessere Vereinbarkeit: etwa eine Elternzeit, die Mütter und Väter gleichstellt, oder ein Arbeitsklima, das den Bedürfnissen von Müttern und Vätern Rechnung trägt. Derzeit wachse an der Uni Bern eine neue Generation von Führungskräften heran, die einen Wandel möchte, so Gregor. Dabei könnten die erwähnten Initiativen helfen. Eine wissenschaftliche Karriere im Bereich Medizin mit dem Muttersein zu vereinbaren, werde jedoch immer ein Spagat bleiben.
Kontakte:
PD Dr. rer. nat. Anne Gregor anne.gregor@unibe.ch
Prof. Dr. Andrew Chan andrew.chan@unibe.ch
Dr. Bettina Zimmermann bettina.zimmermann@unibe.ch




